Der folgende Text ist keine klassische Filmkritik und wird sich auch nicht mit dem Sinn oder Unsinn von Automobilrennen oder Verbrennungsmotoren auseinandersetzen. Vielmehr haben wir es mit einer analytischen und anekdotischen Retrospektive zu tun, die versucht, einen Blick hinter die Kulissen des Filmes Le Mans (1970 / Lee H. Katzin) und seiner Entstehungszeit zu werfen. Wir werden uns also auf die Suche nach jenen Gründen machen, warum dieser Film der beste Rennfilm aller Zeiten ist. Und warum er dies sehr wahrscheinlich auch immer bleiben wird.

Der Versuch einer Rückschau von Manuel Hinrichs
Der Verfasser, in diesem Falle ein Archivar und Rechercheur de Voiture de Course, sowie Datensammler und Filmfreund in Personalunion, wird zu diesem Zweck erstmalig alle ihm zu diesem Thema zur Verfügung stehenden filmischen und automobilen Informationen zusammenführen. Ein grundsätzliches Interesse an der Materie beim Leser wäre da natürlich von Vorteil, denn wir werden uns im Bereich eines Unterhaltungsmediums bewegen (Film!) und uns mit einem „Special Interest“ beschäftigen (Geschichte!). Hier werden wir dann ein nerdiges „Very Special Interest“ (Automobil- und Rennfilme!) vorfinden, welches von einem ultra-nerdigen „Very Very Special Interest“ (Rennwagen!) durchzogen wird, ein Füllhorn an Informationen. Wie bei allen Wissensthemen, wird die wissenschaftlich verbriefte Aufmerksamkeitsspanne von achtkommazwei Sekunden (ein Goldfisch bringt es bekanntlich auf neun Sekunden), die ein durchschnittlicher Internetbenutzer bereit ist, lesend für einen Text aufzubringen, da nicht ganz ausreichen, denn der vorliegende Artikel ist schlicht und ergreifend der längste geschlossene Text, der jemals bei den Medienhuren veröffentlicht wurde. LeserInnen werden also Zeit brauchen. Sehr viel Zeit. Vielleicht in Form einer langen Bahnfahrt (Viel Trinken! Und funktioniert überhaupt die Klimaanlage oder die Bordtoilette?), eines Fluges (Viel Trinken! Außerdem bitte den Gurt schließen und den Anweisungen des Bordpersonals Folge leisten!) oder idealerweise eines Krankenhausaufenthaltes (Viel Trinken! Alles liebe und eine schnelle Genesung!). Aber: Ihr habt auch schon mehr Zeit für größeren Blödsinn aufgewendet.

Bevor wir einen Film wie Le Mans korrekt einordnen können, müssen wir jedoch einen kurzen Blick in das alte Hollywood-Kino Studiosystem und in die Vereinigten Staaten von Amerika werfen. Das ist notwendig, weil einige Le Mans Mitwirkende ihre Kompetenzen ja noch in der „Goldenen Ära“ des Filmes erworben hatten. Außerdem werfen wir nicht nur einen Blick in das „New Hollywood Cinema“, also in jene Ära, in welcher er tatsächlich entstand, sondern wir verschaffen uns auch einen Überblick in das Angebot des Automobil- und des Rennsportfilms. Auch, wenn diese beiden Bereiche in etwa so viel miteinander zu tun haben, wie Kinobesucher mit Filmhistorikern.
Schon immer fanden selbst gut dokumentierte geschichtliche Ereignisse in Filmen meist nur in Form von Stereotypen statt, meist weniger aus Unwissenheit, sondern mehr aus Bequemlichkeit; alle „Cowboys“ waren „gut“ und alle „Indianer“ waren „böse“. Filme sollten unterhalten und genauso waren die Geschichten dann auch aufgebaut. Im Alltag informierte man sich weiterhin in jenen Tageszeitungen, die weitestgehend dem eigenen Weltbild entsprachen, während man komplexe geschichtliche Sachverhalte hauptsächlich in den Schriften des Bildungssektors vorfinden konnte. Bei einem weitergehenden Bedarf informierte man sich in Bibliotheken oder den wenigen schon verfügbaren Fachzeitschriften. Eine Form von Aufwand, welche Zeit und ein hartnäckiges Interesse voraussetzten. Kurz: Es war das Gegenteil von Niedrigschwellig und derartig unterfordert, hinterfragte der Zuschauer natürlich auch nicht die eigene Rolle in der Welt.
Das Interesse an geschichtlicher Authentizität war beim damaligen Publikum also erwartungsgemäß eher gering und spezialisierte Dokumentarfilme waren ebenso wenig erfunden, wie nerdige „Special Interest“-Filme generell oder gar das Internet an sich. All diese Informationen werden uns helfen einzuordnen, welchen Gamechanger der Film Le Mans mit seinem absoluten Anspruch nach Authentizität einige Jahre später wirklich darstellte. Und warum der zeitgenössische Zuschauer davon überfordert war.
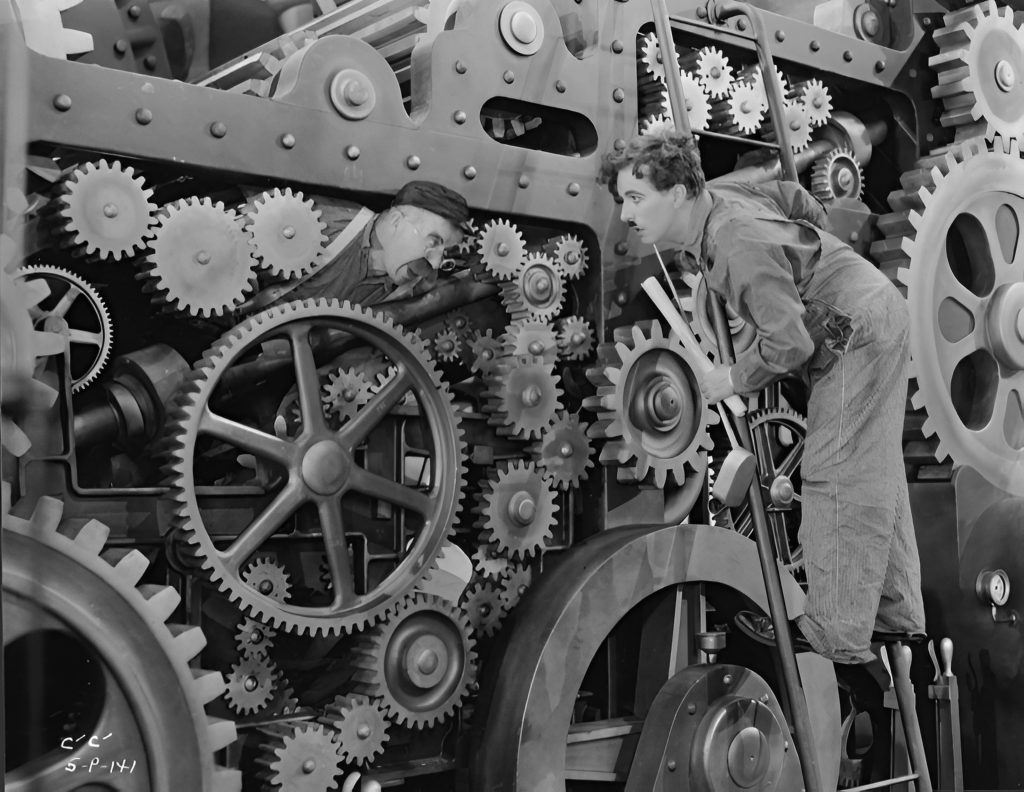
Trotzdem wäre hier ein Überlegenheitsgefühl gegenüber der Vergangenheit unangemessen, wenn nicht gar falsch. Denn, obwohl der moderne Mensch heute das Wissen der Welt mit sich herumträgt, hat sich inzwischen herausgestellt, dass selbst dieser Umstand noch nicht niedrigschwellig genug ist. Insbesondere, wenn das Aufregungspotential und die daraus resultierende Hilflosigkeit des Trägers hauptsächlich durch Wohlstandsstress, eine gestörte Impulskontrolle oder (News-) Fastfood getriggert wird. Auch heute besteht nämlich meist kein gesteigertes intellektuelles Interesse, ein Thema über die Überschrift oder den ersten Absatz hinaus zu vertiefen oder, wenn man es dann doch macht, mehr als nur eine seriöse Quelle hinzuzuziehen. Meist fehlt dafür einfach die Zeit, die Muße oder die Geduld… sogar bei Menschen meines Alters.
Mag es heute zwar sehr viel mehr Möglichkeiten geben, um sich zu informieren, gingen eben auch damals die Durchschnittszuschauer ins Kino, um der Realität zu entfliehen und die Temporallappen zu entlasten, d.h. mental und durchaus auch faktisch, die Füße hochzulegen. Und dies zum Ärger von so manchem echten Filmfan gerne auch mal zwischen den Rückenlehnen der Vordersitze hindurch, sozusagen auf die Armlehne direkt neben einem. Um die Bedürfnisse dieser stumpfen Zellhaufen, sorry, dieser konsumfreudigen Zielgruppe, damals wie heute zu befriedigen, adaptierte man mittels einer über Jahrzehnte perfektionierten Dramaturgie Schablone wirklich jede verfügbare Erzählung in eine unterhaltsame und sorgenfreie Landpartie, respektive in eine zuckerwatteluftige Ausfahrt mit Freunden.
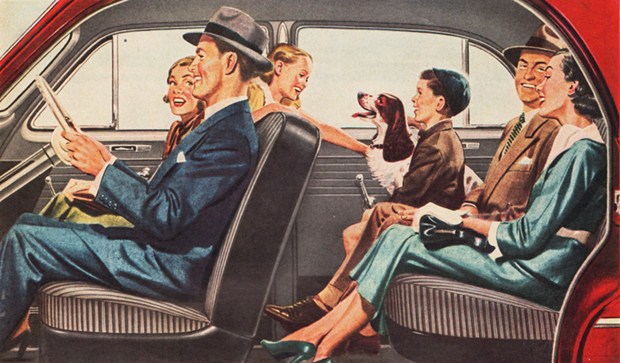
War es also wirklich schon immer so, dass Filmschaffende ihr Publikum nur unterschätz(t)en? Oder bedien(t)en Produzenten und die Regisseure nur ein weltfluchtfreudiges und berieselungswilliges Publikum? Egal, denn das Publikum zahlte Eintritt, und die Produzenten waren zufrieden. Authentizität oder Anspruch geriet da natürlich ins Hintertreffen. Ein reflektierter und reinigender Rundumschlag zur sogenannten „Goldenen Ära“ des Filmes war daher kaum vermeidbar. Auch in diesem Artikel nicht. Denn man hätte sie auch die Ära des Stillstandes nennen können. Tatsächlich hieß dieser Zeitabschnitt u.a. auch deshalb so, weil niemand Zweifel an dem ihm zugedachten Platz hatte.Heute kann man es fast als Wunder betrachten, dass es trotz der Verwendung offensichtlicher „Schema F“-Drehbücher, die vor unangebrachten Glorifizierungen, eindeutigen und wiederholten Herabsetzungen ethnischer Gruppen, aber auch dem Verwenden von Stereotypen, Blackfacing, sowie Whitewashing und Geschichtsklitterungen nicht zurückschreckten, gelang, dennoch Dutzende stilbildende Meisterwerke der Kinokunst entstehen zu lassen. Und das sogar in Europa. An der Spitze dieser Entwicklung könnte man daher sehr wahrscheinlich das mit sieben Oscars ausgezeichnete Film-Epos Lawrence von Arabien (1962) von David Lean verorten. Selten zuvor wurde der europäische Kolonialismus, hier am Beispiel der verbrieften Geschichte historischer Figuren im arabischen Aufstand gegen das Osmanische Reich, gewaltiger, epischer, eleganter und schöner inszeniert. Einige Rollen könnte man heute zwar einer echten kulturellen Aneignung bezichtigen, aber es war dennoch in jeder Hinsicht ein Meisterwerk.Mit fortschrittlichen Kamera- und Tontechniken protzende Hochglanz-Monumentalfilme könnten uns jedoch fast vergessen lassen, dass Filme auch in jenen Jahren fast automatisiert produziert wurden. In der Filmindustrie (sic!) wurden alle für das Ergebnis nötigen Vorgänge durchgetaktet, von der Entstehung bis zur Verwertung.

Für die SchauspielerInnen hingegen, war die Hoffnung auf den zu erwartenden Ruhm die Währung Nummer 1. Die Gagen für die wenigen „Stars“ unter ihnen mochten auch damals schon immens gewesen sein, aber bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen zahlten alle denselben Preis dafür: Knebelverträge, mit denen Studios „ihre“ SchauspielerInnen exklusiv nicht nur für mehrere Jahre, sondern gleich auch noch für mehrere Filme pro Jahr an sich banden. Mit einem eigenen Kopf ausgestattete SchauspielerInnen waren da eher nicht gefragt; sie hatten einfach nur ihre Verträge zu erfüllen. Und rassistische Stereotype waren natürlich ebenfalls von Anfang an ein Teil dieser Welt. Filmklassiker, wie z.B. Vom Winde verweht (1939/ Victor Fleming) zeigten uns nicht nur unreflektiert die Fakten jener Zeit, in welcher der Film spielte. Sondern auch, wann er entstand. Die Hautfarbe gab vor, welche Rollen man bekam. Es waren nämlich jene gesellschaftlichen etablierten Rollen, welche die Beteiligten auch schon aus ihrem Alltag kannten. Mit Clark Gable hatte sich zwar ein mächtiger Fürsprecher für Hattie McDaniel (Bild) in der Rolle der loyalen Sklavin und späteren Hausangestellten eingesetzt, dennoch musste sie bei der Oscar-Verleihung wegen der immer noch allgegenwärtigen „Rassentrennung“ an einem anderen Tisch sitzen als ihre Co-Stars. Und das, obwohl sie dort absolut verdient, und als erste Afroamerikanerin überhaupt, den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle erhielt. Als McDaniel daraufhin von der National Association for the Advancement of Colored People kritisiert wurde, dass sie mit schöner Regelmäßigkeit Rollen annehmen würde, die den damaligen Stereotypen von Afroamerikanern entsprächen, erwiderte sie: „Warum sollte ich mich beschweren, für eine Wochengage von 700,- US-Dollar ein Hausmädchen zu spielen? Wenn ich das nicht täte, wäre ich ein Hausmädchen und mein Wochenverdienst läge bei 7,- US-Dollar!“.

Eines war also klar: Die sogenannte „Goldene Ära“ des Filmes zeigte überdeutlich, wie wenig sich seit den Zeiten des amerikanischen Sklavenhandels geändert hatte. Die Gleichstellungsbestimmungen des Civil Rights Act von 1866 waren juristisch zwar gültig, aber kaum ein Afroamerikaner konnte sich einen Anwalt leisten, um sich dieses Recht auch zu erstreiten. Und wenn doch mal genügend Geld gesammelt wurde, war es fast unmöglich, einen Anwalt zu finden, der das Anliegen auch vor Gericht bringen würde. Eine echte Hürde. Und eine zementierte Kluft. Da ein Recht, das nicht von jedem Bürger, unabhängig von seiner Hautfarbe, seinem Status oder seiner Herkunft, erstritten werden konnte, kämpfte das Civil Rights Movement von 1954 bis 1968 dafür, dass alle Bürger das garantierte Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben würden. Die Rassentrennung existierte also noch bis weit in das Zwanzigste Jahrhundert. Und wie man auch heute noch sehen kann, ist das Gesetz immer noch nicht in alle Köpfe vorgedrungen. Wir haben uns offenbar kaum bewegt. Es waren vielleicht keine weißen Plantagenbesitzer mehr, die sich auf den Sklavenmärkten bedienten, aber es war eine Zeit, in der weiße Studiobosse aus ihren goldenen Büros heraus, wie Cäsaren über die Karrieren innerhalb eines Menschenmarktes entschieden. Jegliche Ähnlichkeiten mit der Vergangenheit waren da bestimmt nur rein zufällig.
Bei Nichterfüllung der Verträge wurde zwar nicht mehr unbedingt mit dem Strick gedroht, dafür aber mit Konventionalstrafen und Rausschmiss. Ganze Generationen von Schauspielkarrieren waren abhängig von den persönlichen Sympathien oder Aversionen der Bosse und im Zweifel lief es auf die physische und psychische Vernichtung derjenigen hinaus, die den Regeln der Studios nicht folgten. Regeln übrigens, die nirgendwo festgeschrieben waren und die je nach Bedarf von den Bossen immer noch nach Gutsherrenart verändert, ignoriert oder befolgt werden konnten. Im Zweifel stand man alleine.

Also endeten Karrieren, gerade auch in jenen Jahren, gerne mal in einer Tabletten- / Alkohol- / Drogenüberdosis, mit einer Nadel im Arm oder mit (Selbst-) Mord. Aber auch für die stabileren Psychen unter ihnen gab es kein Entrinnen, denn natürlich wurde man nicht nur von seinem Studio vor die Tür gesetzt, sondern bekam üblicherweise in ganz Hollywood keinen Fuß mehr in die Tür. Therapien und längere Klinikaufenthalte, sowie Zwangseinweisungen in Nervenheilanstalten gehörten also ebenso selbstverständlich zu dieser Ära, wie der Einsatz kompletter Zweitbesetzungen und Neudrehs.
Weil all diese Unarten natürlich auch Einfluss auf jene Ära hatten, in der dann unser Film Le Mans entstanden ist, muss ich mich leider wiederholen: In der „Goldenen Ära“ mögen filmische Meisterwerke entstanden sein. Aber sie entstanden von Anfang an in einem System aus Machtmissbrauch, Erpressungen, Verrat und Korruption. Ein über Jahrhunderte verinnerlichter und daher natürlich längst institutionalisierter Rassismus, traf nicht nur auf die Mechanismen der Hexenjagden der McCarthy-Ära, sondern waren auf den fruchtbaren Boden der Gier, des Neides und des Misstrauens gefallen. Und mal ehrlich: Den an jedem einzelnen Filmset natürlich schon immer existierenden institutionellen Sexismus, inklusive des beschönigenden und längst in den jovialen Sprachgebrauch übernommenen Begriffs der „Besetzungscouch“ beim Casting, sowie den männlichen Blick der Kamera und die damit verbundene standardisierte Inszenierung der Frau als Objekt, habe ich hier noch nicht einmal erwähnt. Klar war nur, dass dieser „male gaze“ Trashfilme genauso betraf, wie Meisterwerke vom Schlage eines Citizen Kane (1941 / Orson Welles).

Obwohl wir es heute eigentlich besser wissen, ist der Machtmissbrauch an Filmsets immer noch präsent. Und dass trotz wohlfeiler Absichtserklärungen und dem Einsatz von Intimitätskoordiatoren. Bis heute wagte es niemand, das System zu hinterfragen und den Cashflow zu stören. Warum auch? Künstlerischer Anspruch scheint unvereinbar mit monetären Interessen. Und solange das Geld weiterhin in Strömen floss, gab es für Filmregisseure, Autoren und Produzenten überhaupt keinen Anlass, sich weiterzuentwickeln. Die Folgen dieses Fehlers im System kann man bis heute sehen: Simple Dramaturgien und thematische Monokulturen. Natürlich ging die Risikobereitschaft der Filmstudios gegen Null, dem Publikum etwas zuzumuten oder es aus seiner Komfortzone zu holen. Dieses systemische Versagen kann man übrigens bis heute an der „Prequel vom Sequel“-Unterhaltungsfilm-Ideenlosigkei ablesen. Vollends absurd wird es dann, wenn man berücksichtigt, dass dieser Mangel an Risikobereitschaft schon immer so ziemlich genau das Gegenteil dessen war, was man schließlich auf den Leinwänden zu sehen bekam.
In den Filmen lebten durchweg eindimensionale Filmcharaktere nämlich meist in einer simplen „Gut und Böse“-Welt ein langweiliges und geradezu spießbürgerliches Leben, strotzten dann aber geradezu vor Energie, Risikobereitschaft, Einfallsreichtum, Emotionen und Intelligenz, wenn irgendein weltgeschichtlicher Vorfall, ein (Ehe-) Partner, ein Konkurrent, der Chef, ein Freund, ein Feind, eine Krankheit, oder sogar die Fakten anfingen, diese Idylle zu trüben und die Protagonisten gezwungen waren, ihre individuellen Komfortzonen zu verlassen. Aber natürlich mussten sie das nicht alleine tun.
Nein, es waren eher keine Therapeuten oder Psychologen, sondern vielmehr wohlmeinende FreundInnen, MentorInnen, Pfarrer/ Rabbis/ Imame, Freunde und auch Inhaber von Pubs, Kneipenphilosophen oder Obdachlose, welche die Protagonisten an ihre eigenen Stärken oder an irgendeine Art von Gott glauben ließen. Als Gegenleistung erhielten sie dann ihre persönliche zweite Chance, ihre Erlösung, d.h. sie siegten und / oder heirateten die Traumfrau / den Traummann, bekamen den Job / gewannen im Lotto / fanden in einem Hundewelpen den Sinn des Lebens / hatten eine tiefgreifende Erkenntnis oder schlicht und einfach Glück. Ein echtes Märchen eben, eine Heldengeschichte. Und das immer unterschätzte Publikum bekam sein vollkommen übertriebenes Happy End.

So hätte es immer weitergehen können. Die Banken, die Produzenten, die Regisseure und die SchauspielerInnen wähnten sich auf einer Dauerparty. Naja, jedenfalls bis zum Eintreffen des ersten großen Partycrashers, als im Oktober 1962 amerikanische Aufklärungsflugzeuge entdeckt hatten, dass die Sowjetunion Abschussrampen für Atomraketen auf Kuba errichtet hatte. Dreizehn Tage lang hatte man die Aussicht auf Sonnenschutzfaktor 5000. Kaum hatte man sich aber davon erholt, kam der nächste Schock in Form von drei (oder vier?) Kugeln im Kaliber 6,5 x 52 mm: Die öffentliche Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963 dämpfte die Freude am weißen „American Dream“ schon ein wenig nachhaltiger. Im Januar 1963 erschien dann der Film Lilien auf dem Felde (1963/ Ralph
Nelson) mit Sidney Poitier, welcher 1964 für seine Leistung, als erster afroamerikanischer Schauspieler überhaupt, den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller erhielt. War noch irgendwas im Jahre 1964? Bestimmt, aber in der irrigen Annahme, dass Weiße mehr Rechte hätten, begann das Establishment, um sich zu schlagen und ermordete am 21. Februar 1965 Malcolm X. 1966 protestierte man in den USA gegen den eskalierenden Vietnamkrieg und 1967 zeigten sich weitere Risse im sozialen und politischen Gefüge der USA. Bisher verborgene Konflikte wurden sichtbar; der sogenannte „Amerikanische Traum“ explodierte. Ausgelöst von den Gewaltexzessen der Polizei(!) gab es Aufstände in den afroamerikanischen Vierteln u.a. von Detroit und Newark, insgesamt in 125 Städten. Poitier drehte in dieser Zeit In der Hitze der Nacht (August 1967) von Norman Jewison und gleich danach die Familienkomödie Rat mal wer zu
Essen kommt (Dezember 1967) von Stanley Kramer und beide Filme waren klug genug, die notwendige gesellschaftliche Veränderung zu bebildern… das schon lange überfällige Aufbrechen des Status Quo seitens der Filmwelt.

Dieser Traum von einer Veränderung endete aber bereits schon wieder am 4. April 1968. Der Theologe und Menschenrechtler Dr. Martin Luther King wurde von einem Rassisten erschossen. Zwei Monate später wurde dann auch noch der Justizminister Robert Kennedy getötet. Wer aber dachte, dass es nicht schlimmer werden könnte, sah sich getäuscht: Schon im März 1968 hatten US-Soldaten in dem vietnamesischen Dorf My Lai ein Massaker an über 500 alten Männern, Frauen und Kindern verübt. Weil dieses und viele weitere Massaker im Mai 1969 an die Öffentlichkeit kamen, wirkt es aus heutiger Sicht fast schon wieder ein wenig befremdlich, dass man sich bereits im Juli 1969 vor den Fernsehgeräten versammelte, um gemeinsam der Mondlandung beizuwohnen. Ob eine elitäre weiße Veranstaltung aber überhaupt jemals das Potential hatte, die gesamte(!) multiethnische Bevölkerung eines Kontinents zu vereinen, darf an dieser Stelle bezweifelt werden.
Manchen Leser mag dieser geschichtliche Ausflug etwas überrascht oder sogar verstört haben. Das lag natürlich nicht in meiner Absicht, aber es war die Verkettung all dieser Ereignisse, die zu einer Veränderung führten, wie sie die Filmwelt Hollywoods seit Dekaden nicht mehr gesehen hatte. Allein schon deshalb gehören all diese Ereignisse tatsächlich auch in eine Abhandlung über den besten Rennfilm aller Zeiten. Das wird sogar umso deutlicher, wenn man an einen Horrorszenario erinnert, welches ein knappes Jahr vor Beginn der Le Mans-Dreharbeiten geschehen war. Mitte des Jahres 1969 hatte Steve McQueen nämlich gerade seinen Film Der Gauner (1969/ Mark Rydell) abgedreht, der auf William Faulkners gleichnamigen und Pulitzer-Preis veredeltem Roman The Reivers basierte. Produziert wurde der Film von McQueens Solar Productions und von der CBS-Tochterfirma Cinema Center Films/ CCF, von beiden werden wir noch hören.
Auf einer der vielen Partys des Film- und Kulturbetriebes, traf McQueen jedenfalls Sharon Tate und ihren Mann Roman Polanski und natürlich war man begeistert voneinander. Und zwar so sehr, dass sie McQueen auf einen Umtrunk zu sich nach Hause einluden. Kurzentschlossen einigte man sich auf den Abend des 8. August 1969.

Wir werden niemals erfahren was dazu geführt hat, dass McQueen an jenem Abend nicht zu Tates und Polanskis Haus in den 10050 Cielo Drive gefahren ist. Aber da sein Name ebenfalls auf der Todesliste der Manson-Familie zu finden war, hat es ihm sehr wahrscheinlich das Leben gerettet. Allerdings, und diesen Gedanken finde ich überaus spannend, hatte der ExMarine McQueen durch seine Abwesenheit auf der Party auch keine Chance, zum Gegenangriff überzugehen. Kein ganz so abwegiger Gedanke. Einige Jahrzehnte später spielte Quentin Tarantinos Meisterwerk Once upon a time… in Hollywood (2019) mit einem ähnlichen Szenario, in welchem kleine Details dazu führten, dass das Leben von Sharon Tate und ihren Gästen an diesem Abend einen anderen Verlauf nahm. Es bleibt aber eine Hypothese, denn was aber auch immer hätte sein können, werden wir niemals erfahren und der Abend verlief für die Anwesenden auf der Party leider nun mal tödlich. Fest steht aber auch: Weil Partymaus McQueen für dieses Mal eben nicht zu einer Party ging, konnte er dem Publikum weiterhin jene Filme schenken, die längst in die Geschichte eingegangen sind.
Nur eine Woche später fand vom 15. bis 18. August 1969 vor 400.000 Besuchern zwar noch das große Musikfestival in Woodstock statt, aber auch das konnte nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass die „Love&Peace“-Bewegung der Hippies längst ihre Unschuld verloren hatte. Es mag sich gruselig lesen, aber es war genau dieses Aufwachen, dieses Ende aller aufgestauten Verdrängungen, welches nötig war, dass endlich auch die Filmwelt zu einem evolutionären Sprung ansetzen würde. Festzustellen war nämlich, dass es ab diesem Zeitpunkt zu einer deutlich sichtbareren nihilistischen Grundstimmung in den Filmwerken kam, oder anders ausgedrückt: Die Weichen der Filmindustrie waren neu gestellt worden und es entwickelte sich das „New Hollywood Cinema“. Wiederkehrende Merkmale waren hierbei die auf ein absolutes Minimum reduzierten Handlungen und die geradezu existenzialistische Wortkargheit. Man hatte endlich begonnen, die gesellschaftlichen Realitäten zu spiegeln. Als erster Vertreter dieses nihilistischen Nebengenres erschien der Film Easy Rider (1969 / Dennis Hopper), in welchem, zum Argwohn einiger Hinterwäldler, Peter Fonda, Jack Nicholson, und Dennis Hopper friedlich ihrem freiheitlichen Leben nachgingen. Die Inspiration hierfür hatte sich Hopper aus Jack Kerouacs Roman On the Road – Unterwegs geholt, der bereits im Jahr 1951 geschrieben, und 1957 erstmalig verlegt worden war. Japp, man könnte schlechtere Vorbilder haben.
Wie dicht dieser Film aber an den Abwehrmechanismen des um sich schlagenden, erzkonservativen Bürgertums war, zeigte der Vorfall auf dem Gelände der Kent State University im April 1970, als Studenten friedlich gegen die völkerrechtswidrige US-amerikanische Bombardierung Kambodschas demonstrierten. Nachdem der Versuch der Nationalgarde(!) gescheitert war, eine friedliche, aber nicht genehmigte Protestkundgebung mit Tränengas(!) aufzulösen, zogen die Soldaten sich auf eine Anhöhe zurück und erschossen aus 100-150 Meter Entfernung gezielt vier unbewaffnete Studenten, unter ihnen sogar einen Querschnittsgelähmten. In dreizehn Sekunden wurden 67 Schüsse abgegeben, angeblich unter Notwehr. Neun weitere Studenten wurden schwer verletzt und wie auch schon nach My Lai, wurde auch in diesem Fall niemand zur Rechenschaft gezogen. Die Folge war die Schließungen von hunderten Schulen und Universitäten, landesweit streikten circa acht Millionen SchülerInnen und StudentInnen, viele radikalisierten sich. Zu dem menschenverachtenden Umgang der Behörden mit Andersdenkenden kam, dass es die US-amerikanische Gesellschaft bisher recht erfolgreich verdrängt hatte, dass sie „ihr“ Land auf der Verschleppung und Versklavung von ca. vierzig Millionen Afrikanern und auf dem Völkermord an der einheimischen indigenen Bevölkerung aufgebaut hatten. Die Wut brach endlich hervor und etwas musste geschehen.

„The Land of the Free and the Home of the Brave“ meinte selbstgewiss das Land der Weißen (der Eindringlinge!) und der „American Way of Life“ war im Kern das selbstgegebene Recht, sich mit Waffengewalt die Vorherrschaft zu sichern. Da die Probleme längst nicht mehr zu ignorieren waren, kann das „New Hollywood Cinema“ daher auch als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umbrüche angesehen werden. Eine neue Generation von jungen Filmemachern fing an, etwas vollkommen Neues zu versuchen. Unter den Eindrücken der unterschiedlichen Lebensrealitäten und Interessenslagen innerhalb der Gesellschaftsschichten begannen sie, die Grenzen filmischer Erzählungen zu verschieben. Genreübergreifend war es das Besondere an den zwischen ca. 1967 und circa 1977 gedrehten Filmen, dass sie sich normativer Antworten auf nicht gestellte Fragen schlicht verweigerten. Stattdessen fingen diese Filme an, Fragen zur menschlichen Existenz aufzuwerfen, zur Rolle des Menschen an sich. Während der alte Senior Hollywood auf dem letzten Loch pfiff und es sich in seinem Ruhm bequem gemacht hatte, ja, geradezu erstarrt war, holte der Junior des „New Hollywood Cinema“ nun tief Luft und setzte zum Sprung an.
Unter dem Deckmantel eines Science-Fiction-Unterhaltungsfilmes entstand mit dem Film Planet der Affen (1968) von Franklin J. Schaffner auf diese Weise nicht nur eine veritable Rassismus-Parabel, sondern auch gleich eine komplette Filmreihe. Einzige Einschränkung: Zu diesem Thema musste es noch eine Parabel sein, denn den institutionellen oder auch den gesellschaftlichen Rassismus offen und direkt anzuprangern, hätte zu diesem Zeitpunkt durchaus zu Repressionen von der fundamentalistischen religiösen Rechten, ganz sicher aber zu FBI-Ermittlungen wegen Extremismusverdachts nach sich gezogen. Der in ideologischen Dogmen erstarrte Kommunismus war sicherlich noch nie die Zukunft aber in den USA galt fortschrittliches Denken schon immer als Sozialismus und wurde als staatsfeindlich eingestuft. Der Gift und Galle spuckende Senator Joseph McCarthy war zwar bereits seit 1957 tot, doch die gesellschafts- und kulturzersetzenden Mechanismen seiner von ihm initiierten Schauprozesse waren in der erzkonservativen und religiösen Rechten immer noch allgegenwärtig. Es war dieses aufgeladene Klima, in welchem sich die neuen Filme direkt oder indirekt anschickten, die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Realitäten zu beleuchten. M*A*S*H (1970 / Robert Altman) und Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (1971 / Robert Wise), Silent Running – Lautlos im Weltraum (1972 / Douglas Trumbull) und Soylent Green – Jahr 2022… die überleben wollen (1973 / Richard Fleischer), Logan’s Run – Flucht ins 23. Jahrhundert (1976 / Michael Anderson) und natürlich der desillusionierte Taxi Driver (1976) von Martin Scorsese standen beispielhaft für die neue erzählerische Richtung dieses nun „New Hollywood“ genannten Aufbruches.

Der Hollywood-Glamour der 1940er/1950er und der beginnenden 1960er Jahre wurde von einem gesunden Fatalismus, Pragmatismus und Realismus verdrängt. Das „New Hollywood“-Kino war auch angetreten, um dort hinzuschauen, wo es wehtut. Intelligente, aber unverdächtige Filmstoffe begannen, die menschliche Hybris zu dechiffrieren. Thematisiert wurden die Grenzen der Technik genauso, wie die zunehmende Umweltverschmutzung, den gesellschaftlichen Verfall inklusive des Nichtvorhandenseins der Gleichberechtigung von Mann und Frau, und natürlich auch das Krebsgeschwür des allgegenwärtigen Rassismus. Zusätzlich griffen aber auch Ängste vor einem sich verselbstständigenden militärisch-industriellen Komplex um sich, die gerade von dem völkerrechtswidrigen Engagement von US-Truppen in Lateinamerika und Südostasien nur noch mehr bestätigt wurden. Tiefes Misstrauen in die staatlichen Institutionen waren durchaus berechtigt, denn zu diesem Zeitpunkt waren u.a. die Polizeibehörden von New York und Los Angeles bis in die Führungsspitzen derartig korrupt, dass man bestimmt, nicht falsch gelegen hätte, wenn man sie der Exekutivabteilung des organisierten Verbrechens zugeordnet hätte.
Die einzige Institution, der man in diesem vergifteten Sumpf überhaupt noch so etwas wie Vertrauen entgegenbrachte, war die unabhängige und freie Presse. Also entstanden Filme, welche dieses tiefe Bedürfnis nach ausgleichender Gerechtigkeit zum Ausdruck brachten. Die Veröffentlichung von Rechercheergebnissen führten allerdings nicht zwangsläufig zum Erfolg. Oft genug zeigten diese Filme daher die Grenzen des ambitionierten Journalismus auf und bebilderten dadurch ein ums andere Mal den einsamen Kampf Davids gegen Goliath.

Dieses Motiv war extrem beliebt und wurde u.a. in den Filmen Die drei Tage des Condor (1975) und Die Unbestechlichen (1976), beide von Sydney Pollack und dem Deep-Fake Film Unternehmen Capricorn (1977) von Peter Hyams genutzt. Außerdem muss an dieser Stelle der prophetische Atom-Thriller China Syndrom (1978) von James Bridges genannt werden, in welchem es um einen Störfall in einem Kernkraftwerk ging. Prophetisch deshalb, weil es nur ein Jahr später, am 28. März 1979, im Block 2 des Kernkraftwerkes Three Mile Island in Harrisburg, Pennsylvania, tatsächlich zu einer teilweisen Kernschmelze kam. In dem Whistleblower-Thriller Silkwood (1983/ Mike Nichols) mit Meryl Streep deckte die Chemietechnikerin Karen Silkwood im Jahr 1974 eklatante Sicherheitsmängel in der Kerr-McGee-Plutonium-Aufbereitungsanlage auf. Im November 1974 hatte sie es endlich geschafft, sich Gehör zu verschaffen und wollte sich mit einem Journalisten der New York Times treffen aber auf dem Weg dorthin kam sie bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Dieser „No Nonsens“-Nachzügler war sicherlich Angstkino aber in dem verhältnismäßig kleinen „New Hollywood“-Zeitfenster entstanden so ein paar Dutzend der besten und vielfältigsten US-Filme aller Zeiten. Filme mit einem echten Anliegen. Und es waren Anliegen, welche immer über die erzielbaren Profite hinaus gingen. Da Betriebswirte ohne Filmkenntnisse die Film-, Kunst- und Kulturszene der Vereinigten Staaten von Amerika zu diesem Zeitpunkt noch nicht gänzlich unter Kontrolle hatten, war es möglich geworden, sich selbst zu ermächtigen und sich einen eigenen Neorealismus zu schenken. Alleine die Aussagekraft der Filme dieser 10-15 Jahre währenden Ära, sollte wirklich jeden Autoren und jeden Produzenten moderner Unterhaltungsfilme sofort vor Scham im Boden versinken lassen. Sicher: Für die Filme des „New Hollywood“ braucht man Geduld und offene Augen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, schaut sie euch an. Am besten in einem klassischen Kino, wie dem Le Grande Rex in Paris.

Dennoch gab es auch damals schon erste sichtbare Dämpfer. Mit Sci-Fi-Soaps wie Star Wars (1977/ George Lucas) geriet der Traum des gesellschaftlichen Fortschrittes gleich schon wieder ins Stocken und es gab eine Rückwärtsbewegung, eine Übersprungshandlung in Richtung des reinen Unterhaltungsfilmes aber Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1978/ Ridley Scott) machte einen Schritt zur Seite und eröffnete den Horizont der Zuschauer zum Glück auch in Richtung des Sci-Fi-Horrors.
Beiden Filmen musste man aber zugutehalten, dass sie mindestens die Grenzen der Tricktechnik so nachhaltig verschoben hatten, dass die Filmindustrie bis heute davon profitiert. Mehr noch: Weil eben auch die progressivsten Filmemacher nicht alleine vom ehrenhaften Anliegen ihrer Filme leben konnten, sorgten die neuen Franchise- und Merchandise Konzepte dafür, dass es unter den Filmemachern schon bald die ersten Milliardäre gab. Aber das ist eine andere Geschichte.
Der kurze Traum des „New Hollywood“ findet hier hauptsächlich deshalb Erwähnung, weil der Film Le Mans mit seinem Produktionsjahr 1970 einerseits zwar genau in diese heiße Zeit fiel, andererseits aber keinerlei gesellschaftskritische oder politische Ansätze hatte.
Und doch: Bei der Form atmete dieser Film den absoluten Realismus seiner Entstehungszeit. Das war deshalb spannend, weil das alte „Golden Age“ Hollywood-System natürlich auch hinter den Kulissen dieses Filmes zu bröckeln anfing. In diesem speziellen Fall waren es die Produzenten und die Regie, die immer noch in den verinnerlichten Regeln des alten Hollywood-Studiosystems feststeckten. Hochmotivierte Schauspieler mit einem progressiven Rollenverständnis trafen in Le Mans auf Altvordere, die ihre Filme weiterhin so drehen wollten, wie sie es schon immer gemacht hatten. Und dass, obwohl die Notwendigkeit einer Generalüberholung schon längst für jedermann sichtbar war… sogar auch schon daheim.

Der Wandel betraf jedoch nicht nur alte Wellblechbuchstaben an einem verzinkten Metallgerüst. Auch die Geschichten hatten sich verändert. Im gleichen Maße, wie rückständige Ansichten und Gesellschaftsmodelle von der aufklärerischen Moderne verdrängt wurden, hatten auch kulturelle Errungenschaften, wie z.B. die Bedeutung der Mobilität weiter zugenommen. Und man zeigte es. Waren Automobile vom Anfang aller (Film-) Tage an kaum mehr als ein Teil der Ausstattung, ähnlich einem Pferd, das man vor dem Saloon abstellte, wurden sie in der Ära des „New Hollywood“ erst zu beeindruckenden Nebendarstellern, dann zu Darstellern auf Augenhöhe. Sie übten zwar weiterhin ihre Funktion als Symbol für Mobilität und absolute Freiheit aus, nur stand das Pferd jetzt nicht mehr vor dem Saloon, sondern hatte seinen Platz am Tisch gefunden. Mehr noch: Es schickte sich an, eine eigene Sprache zu entwickeln. Von Anfang an waren Automobile deshalb nicht nur für den Auftritt der Helden zuständig, sondern auch für den Auftritt der Antagonisten, zum Beispiel innerhalb des Genres der allseits beliebten Polizeikrimis. In ihnen waren Kraftfahrzeuge nicht nur als Teil der filmischen Erzählung positioniert, sondern die Filmemacher fingen an, ihre äußeren Merkmale zu inszenieren und ihnen Charaktereigenschaften zu verpassen; das Automobil machte keinen Hehl mehr daraus, von wem es gefahren wurde.
Und nachdem Industrielle, Banker und sonstige Gangster zunächst nur in Fahrzeugen mit gedeckten Farben und dunkel getönten Scheiben herumgefahren waren, kamen in den Filmen des „New Hollywood“ nun zunehmend Fahrzeuge zum Einsatz, denen man nicht mehr direkt „in die Augen“ schauen konnte, weil die Scheinwerfer hinter Klappen versteckt waren. Vielleicht hatte es mit den geschlossenen Scheinwerferblenden des schwarzen Dodge Charger R/T in dem bahnbrechenden Film Bullit (1968) von Peter Yates begonnen. Der erzielte Effekt war wie eine Sonnenbrille am Pokertisch: Mysteriös, aber Souverän. Es wirkte aber, als verweigerten nicht nur die namenlosen Insassen die Kontaktaufnahme mit der Außenwelt und irgendwie war es auch ganz bezeichnend, dass diese abweisende Distanz ein beliebtes Stilmittel des US-Automobildesigns jener Jahre war.

Die geschlossenen Lichtblenden des dunkel-braunen Lincoln Continental Mark III in dem Film French Connection – Brennpunkt Brooklyn (1971) von William Friedkin brachten diesen Trend dann zur Perfektion. Und setzten sogar noch einen drauf. Mit einem französischen(!) Kennzeichen ausgestattet, glitt der Antagonist mit diesem Wagen zunächst durch die Straßen New Yorks, später aber auch noch durch Marseille, und unterstrich auf diese Weise sogar schon im Jahre 1971 die selbstverständliche Grenzenlosigkeit, in welcher das organisierte Verbrechen agierte.
Die Filme dieser Ära wurden also nicht nur künstlerischer, visueller und inszenatorischer. Nein, allerkleinste Details konnten mit einer Bedeutung aufgeladen werden.
Man denke nur an Asphaltrennen aka Two Lane Black Top (1971/ Monte Hellman) mit den beiden wortkargen „Beachboys“ James Taylor und Dennis Wilson in ihrem einzigen Ausflug ins Schauspielfach, sowie selbstverständlich an das Stilmittel des „unsichtbaren“ LKW-Fahrers im Film Duell (1971/ Steven Spielberg) mit Dennis Weaver aber natürlich auch an die alternativlose Endgültigkeit des Fahrers im Film Fluchtpunkt San Francisco (1971/ Richard C. Sarafian) mit Barry Newman.

In all diesen Erzählungen wurden die Fahrzeuge nicht nur zum Überbrücken von Entfernungen genutzt, sondern waren immer auch das Lebenszentrum ihrer Fahrer. Meist waren es Einzelgänger, schweigsame Cowboys, die mit sich im Reinen waren. Oder eben auch nicht. Aber dann hatten sie zur Not immer eine Knarre im Handschuhfach. Fahrzeuge waren vermeintlich sichere und mobile Oasen, die das Überleben in einer feindseligen Welt ermöglichen konnten. In den Innenräumen dieser Fahrzeuge fand nicht nur die Gegenwart des Hauptdarstellers, sondern auch des Publikums statt, während hinter dem Wagen das zurückgelassene „alte Leben“ lag. Vor der Motorhaube lag hingegen immer das „Unbekannte“ und meistens war es eine Fata Morgana, irgendeine Chimäre, irgendwelche Gespinste oder sonstige spukhafte Fernwirkungen. Die erhoffte Zukunft war nur in den allerseltensten Fällen verheißungsvoll. Entscheidend war hier nur, dass man in Bewegung blieb, denn wer ruhte, der starb. Ein „Warum?“ stand niemals zur Debatte.
Als subkultureller Katalysatoren spiegelten diese Road Movies jedoch auch immer die Zeit ihrer Entstehung. 1973 hatten die arabischen Ölstaaten ihre Fördermengen gedrosselt und der Preis für einen Barrel Öl war um das Vierfache angestiegen. Und 1979 kam dann ja schon der nächste Ölschock. Da war es nur folgerichtig, dass sich ein weiteres Automobil lastiges Nebengenre entwickeln würde: Das Endzeit-Roadmovie! Einer der ersten Vertreter dieser Gattung war Mad Max (1979 / George Miller) und kam aus Australien.

Mit 12 Jahren wurde ich im Kino damals Zeuge der Metamorphose eines Familienvaters und Highway-Polizisten in einen gnadenlosen Rächer. Ob die Geschichte einer apokalyptischen Welt, in welcher es um Benzin-Knappheit und das „Recht des Stärkeren“ ging, genau das Richtige war, um ein halbwüchsiges Kind aus seiner Komfortzone zu holen, überlasse ich mal der Phantasie der Leserschaft. Mad Max erhielt 1981 und 1985 jedenfalls noch zwei Fortsetzungen, sowie 2015 und 2024 zwei weitere Upgrades. Der neuseeländische Regisseur Harley Cokeliss haute 1982 mit seinem Film Der Kampfkoloß dann in die gleiche dystopische (FSK16) Kerbe. Und in Deutschland war ich wieder dabei, als einer von knapp 595.000 Zuschauern. Zum Vergleich: Im selben Jahr hatte E.T.-Der Außerirdische von Steven Spielberg sportliche 7,6 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt.
Dennoch gab es auch harmlosere Automobil-Filme, deren Storylines sich nicht nennenswert von denen der Endzeit-Roadmovies abhoben. Der grundsätzliche Unterschied war letztlich, dass in ihnen die menschlichen Darsteller nicht an ihrer eigenen Existenz litten. Als eine Art Prototyp dieser locker flockigen und nicht ganz ernst gemeinten „Car-Coms“ (Mehr „Com“ als „Cars“) kann der recht frühe Eine total, total verrückte Welt (1963 / Stanley Kramer) mit Spencer Tracy durchgehen, der viele schneller abgespielte, mit einigen wenigen echten Außenfahraufnahmen, sowie mit im Studio abgefilmten Rückprojektionen kombinierte. Nur zehn Jahre später zeigte der Detektiv-Krimi Diamantenlady (1973) von Tom Gries dann unzählige originale Supercars in durchweg echten Fahraufnahmen. Hier wurden tatsächlich extrem seltene Maserati Ghibli Spyder und Ferrari 365GTB/4 Daytona Coupe forciert an ihre Grenzen gebracht und dabei ohne Trickshots abgefilmt. Hut ab, obwohl der in jeder Hinsicht wohl absolute Wahnsinn wahrscheinlich vom Film Die Blechpiraten aka Gone in 60 Seconds (1974 / H.B.Halicki) mit 93 zerstörten Fahrzeugen eingeleitet wurde. Die lokalen Automobilverwerter dürfte es gefreut haben.

Schon 1975 spülte der Film Frankensteins Todesrennen aka Death Race 2000 (1975 / Paul Bartel) mit David Carradine und Sylvester Stallone die Restwürde des Menschen dann endgültig ins Klo. Durch die Lichtbrechung der Kult-Trashbrille wird heute gerne vergessen, dass Bonuspunkte für absichtlich in einem „Spiel“ getötete Passanten auch damals schon menschenverachtend und stumpfsinnig waren. Und dies lange vor den Untiefen des Privatfernsehens. Aber wir kommen natürlich zu spät. Im Mainstream angekommen, ist es inzwischen ein Teil der Grand Theft Auto/ Playstation-Popkultur. Der einzige Unterschied zu damals ist, dass man nun selbst entscheidet, wen man überfährt… vielleicht eine Stricherin, einen Polizisten oder einen alten Mann. Vielen Dank für so wenig kulturellen Fortschritt, wirklich. Nachdem ich auch diesen Film viel zu früh im Kino sah, entwickelte sich bei mir jedoch glücklicherweise kein größerer Hang zu zynischen und stumpfen Blutorgien und auch nicht zu Fanatasycars vom Schlage eines Batmobils, sondern ich wandte mich den realen und außergewöhnlichen Fahrzeugen zu.
Zum Glück tat sich diesbezüglich ein kleines Zeitfenster auf und es erschienen Actionkomödien mit echten Supercars, zum Beispiel der Film Die Verrückteste Rallye der Welt aka The Gumball Rally (1976) des Stunt-Koordinators und Regisseurs Charles Bail, sowie im selben Fahrwasser auch der Film Cannonball (1976 / nochmals von Paul Bartel). Beide Filme basierten auf dem gleichnamigen und seit einigen Jahren stattfindenden Cannonball Rennen, einem Rennen von New York nach Los Angeles, dessen erste Austragung im Jahre 1971 vom Car&Driver-Chefredakteur Brock Yates und dem Gewinner der 24 Stunden von Le Mans 1967, Dan Gurney, auf einem Ferrari 365GTB/4 Daytona Coupe überlegen gewonnen wurde. Hiervon inspiriert, drehte der ehemalige Stuntman und Regisseur Hal Needham dann die familienfreundlicheren Filme Ein ausgekochtes Schlitzohr (1977) und natürlich Auf dem Highway ist die Hölle los (1981), beide mit Burt Reynolds. Und wie immer, wenn etwas gut funktioniert, zog auch dieser Film noch ein paar Fortsetzungen nach sich. Auf dem Highway ist wieder die Hölle los (1983 / auch Hal Needham) und Cannonball Fieber-Auf dem Highway geht’s erst richtig los (1989 / Jim Drake) versuchten noch, die Faszination des Strassenrennens lebendig zu halten, aber wenn man sich ehrlich macht, dann hatte sich bei diesen Nachzüglern der (Zeit-) Geist bereits wieder in die Flasche zurückgezogen.

Aufgelockert wurde dieses Genre durch den Truck-Western Convoy (1978) von Sam Peckinpah. Und der Film Blues Brothers (1980/ John Landis) bildete dann weitestgehend das Ende dieser Genre-Fahnenstage ab. Deshalb wurde hier nochmal alles aufgeboten, was man in die Finger bekam. Die beiden Helden des Filmes gerieten an hartnäckige State Troopers, dumme Nazis und nachtragende Exfrauen. Heute fast unvorstellbar, aber man hatte das Genre des Buddymovie erfolgreich mit Motiven des Auto- und Musikfilms aufgelockert. Jake (John Belushi) und Elwood (Dan Aykroyd) waren im Namen des Herrn unterwegs, trugen Sonnenbrillen und bewunderten in einer Mall den neuen Oldsmobile, der dieses Jahr früh rausgekommen war. Blues- und Soul-Legenden wie Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway, John Lee Hooker und James Brown gaben sich ein Stelldichein, während eine mit einer absurden Panzerfaust bewaffnete Carrie Fisher (möge die Macht mit ihr sein) und Twiggy am Steuer eines Jaguar E-Type Roadster erfolgreich entgegen ihres Images besetzt wurden. Das nebenbei auch noch 103 Fahrzeuge zerstört wurden, machte diesen Film zu einer absoluten Autocrash-Orgie. Zwar hatte man sich inhaltlich seit 1974 offenbar im Kreis gedreht und die Car-Crash-Cash-Cow gemolken, aber bis heute habe ich diesen Film 38 mal gesehen, davon 36 mal im Kino, und mich niemals gelangweilt.

Zu meinem Erstaunen versuchte sich zum selben Zeitpunkt aber sogar eine deutsche TV-Komödie an einem Automobilfilm: Carnapping (1979/1980) von Wigbert Wicker. Dieser Film bot etwas, was selbst die Amerikaner nicht hinbekamen. Neben einer, für einen deutschen Film und jener Zeit, ungewöhnlich intelligenten Story, sowie vierzig(!) originalen Porsche 911, konnte er mit einem absolut einmaligen automobilen Einzelstück aufwarten, dem Prototypen CW 311 der Firma bb von exPorsche Ingenieur Eberhard Schulz und Rainer Buchmann. Nach einem Streit der Beiden löste sich die Firma bb irgendwann auf und Schulz gründete die Firma ISDERA, in welcher er das Design des CW 311 für sein neues Modell Imperator 108i übernahm. Der Anblick war unvergesslich, als ich, kurz vor Erreichen des Nürburgrings, und 36 Jahre nachdem ich den Film gesehen hatte, hinter einem Isdera Imperator 108i herfuhr.
Aber: Alle Filme dieser Ära funktionierten weiterhin nach dem „Gut und Böse“-Prinzip des alten Hollywood-Westerns. Neben den Fahrzeugen, welche die Bedürfnisse oder die Seelenwelten der menschlichen Protagonisten widerspiegelten und auf diese Weise ein eigenes Rollenprofil mit eigenen Charaktereigenschaften erhielten, gab es jedoch, quasi als Neben-Nebenzweig dieses Nebengenres, auch damals schon Filme, in denen die Automobile faktisch zum Leben erwachten und menschliche Eigenschaften annahmen. Beispielhaft hierfür stehen die Abenteuer des verlässlichen Kumpels Herbie – Ein toller Käfer (1968 / Robert Stevenson), der nicht nur absolut seltene automobile Nebendarsteller in Form je eines Bizzarrini GT 5300 Strada, Ferrari 250GT TdF, Ferrari 250GT SWB, Lamborghini 400GT und Apollo 3500GT aufbot, sondern bis 1982 sogar eine ganze Kinofilmreihe nach sich zog. Ganz zu schweigen von der ganz ähnlich gelagerten deutsch/schweizerischen 5-teiligen TV-Filmreihe um den gelben VW Käfer Dudu (1972-1978).
Ja, das war eine reine TV-Produktion, aber immerhin hatte man sich hier an der Benchmark dieses speziellen Genres versucht. Etwas, was das deutsche Fernsehen inzwischen leider verlernt hat. Im Gegensatz zu Herbie und Dudu war die eifersüchtige Christine (1983) von John Carpenter allerdings eine echte Bitch und auch der Trashhorror Der Teufel auf Rädern (1977) von Elliot Silverstein trieb die Idee der Fahrzeuge mit menschlichen Eigenschaften auf die Spitze. Das mordlustige Automobil dieses Filmes sah nicht nur wie eine Karikatur des in French Connection gezeigten Lincoln Continental Mark III aus, sondern basierte sogar auf einem Fahrzeug des gleichen Typs. Moviecar-Customizer George Barris hatte hier ganze Arbeit geleistet.

Sicherlich war aber nicht nur Filmfreunden, sondern auch dem automobilen Fachpublikum aufgefallen, dass das Genre der ernsthaften automobilspezifischen Filme in den 1980er Jahren durchaus ein paar Jahre lang brach lag. Man hatte wohl andere Sorgen und so überbrückten die echten Autofans diese Trockenzeit mit TV-Ware. Als Beispiel kann die nicht ganz ernstgemeinte US-amerikanische TV-Serie Ein Duke kommt selten allein (1979-1985) herhalten, für die zwischen 150 und 309 Exemplare (die Quellen sind sich da uneins) des absolut oberkultigen Dodge Charger „verbraucht“ wurden. Aber auch die TV-Serien Knight Rider (1982-1986), Miami Vice (1984-1989) und Magnum (1984-1991) fielen in dieses Jahrzehnt, wenngleich hier die durchaus immer noch ansehnlich inszenierten Fahrzeuge aber schon wieder zu hübschem Beiwerk degradiert worden waren. Black Moon (1986 / Harley Cokeliss), eine Mischung aus Heist- und Autofilm, ist da heute schon fast wieder vergessen und dem deutschen TV-Film Killing Cars (1986 / Michael Verhoeven) mit Jürgen Prochnow ging es da nicht sehr viel anders, obwohl gerade dieser in der Nachbetrachtung durchaus eine Brücke in die Gegenwart schlug: Ein Erfinder entwickelte hierin ein Fahrzeug, welches ohne fossile Brennstoffe auskommt. Die bösen Vertreter der Ölindustrie versuchten daraufhin natürlich, die Markteinführung des Wagens zu verhindern. Das kommt einem doch irgendwie bekannt vor. Während man auf dem Cover der VHS-Kassette jedoch die Front des amerikanischen Supercars Vector W2 mit einem 600PS Biturbo Chevrolet V8-Motor sehen konnte, sah man im Film dann nur einen modifizierten Albar Sonic mit einem 100PS-Motor aus einem Volkswagen; eine echte Enttäuschung. Juristisch wäre das Cover heute wohl eine Mogelpackung aber mit etwas Wohlwollen könnte man es auch als frühe Form von Downsizing bezeichnen. Der Film war seiner Zeit also in jeder Hinsicht weit voraus. Ehrlicherweise war das aber auch schon alles, wofür dieser Film in Erinnerung blieb. Die Chance, zu diesem Zeitpunkt in die Geschichte einzugehen, war aber ohnehin sehr gering, denn die Zurück in die Zukunft-Filme von 1985, 1989 und 1990 (Regie: Robert Zemeckis) überstrahlten längst alle weiteren Mitbewerber und machten John Z. DeLoreans Sparten-Auto De Lorean DMC-12 auch bei derlei bisher unbefleckten Zuschauern weltberühmt.

Allerdings leider nicht berühmt genug. Denn bis heute kann man erwachsene „Fans“ dabei beobachten, wie sie die gebürsteten Edelstahl-Karosserien öffentlich gezeigter Wagen mit ihren fettigen Fingern betatschen. Ganz so, als ob sie nicht wüssten, dass es selbst mit Spülmittel fast unmöglich ist, derartige Fingerprints herauszupolieren. Und dieses, ohne die gebürstete Struktur des Edelstahls zu zerstören. Und ja, ich weiß natürlich, dass man es mit Zitrone und Backpulver ganz gut hinbekommt. Aufgrund des Risikos von Säureflecken muss man dann aber die ganze(!) Oberfläche behandeln. Ein extrem ärgerlicher Aufwand für hochsensible Besitzer, die ihre Wagen bei gehäuft vorkommenden Ereignissen dieser Art lieber in der Garage lassen und ihn deshalb nur noch sehr ungern auf öffentlichen Veranstaltungen zeigen. Danke „Fans“.
Mit so etwas mussten sich die Besitzer des folgenden automobilen Darstellers bestimmt nicht herumschlagen. In Form des Filmes Tucker (1988/ Francis Ford Coppola) mit Jeff Bridges, erschien nämlich ein glasklares Automobil-Biopic auf der Leinwand, die Geschichte eines Geschassten. Mit den Sicherheitsfeatures seines 1948er Tucker Torpedo (Gepolsterte Kanten im Innenraum! Anschnallgurte! Kurvenlicht! Scheibenbremsen! Kein Flux-Kompensator!) war Preston Tucker längst wirklich in der Zukunft angekommen und offenbarte so die unglaubliche Rückständigkeit seiner Konkurrenten. Am Ende war er dann wohl zu weit voraus, denn er wurde von ihnen in den Bankrott getrieben.
Diese Filmproduktion ließ es wirklich krachen, denn das Besondere war, dass hier neben vier kompletten Tucker-Reproduktionen aus Fiberglas, unglaubliche 22 originale Fahrzeuge zu sehen waren! Das waren nahezu die Hälfte der noch 47 existierenden Exemplare von ursprünglich 51 gebauten Fahrzeugen. Dieser Film zeigte recht gut, was passieren kann, wenn ein echter Fan einen Film über das Objekt seiner Leidenschaft macht. Zum Zeitpunkt des Drehs besaß Coppola nämlich selbst einen oder zwei Tucker Torpedo. So, wie auch sein Regie-Kumpel George Lucas. Aber der hatte bekanntlich längst eine andere Richtung eingeschlagen.
Dann entdeckten die Filmemacher der ausgehenden 1980er Jahre, wahrscheinlich auf ein geheimes Zeichen hin, sogar den Rennfilm wieder. Jedenfalls fast. Denn die NASCAR-Soap Tage des Donners (1990/ Tony Scott) mit Tom Cruise und Nicole Kidman war leider eine offensichtliche Top Gun-Storyreplica. Aber immerhin konnte sie mit dynamisch gefilmten originalen NASCAR-Rennwagen aufwarten. Und das geht letztendlich nur auf eine Weise: Nämlich auf die harte Tour!

Angemerkt werden muss hier aber auch das Indy 500-Scharmützel Driven (2001 / Renny Harlin), der mit Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Til Schweiger und Verona Pooth glänzen konnte. Was für eine Darstellerkombination. Auch hier gab es ein Dutzend originaler Rennwagenchassis, wie z.B. Reynard 2K1 oder Lola B2K (darunter Leihgaben des heute immer noch aktiven Chip Ganassi Racing Team), aber auch diese Bemühungen konnten nicht verhindern, dass die Handlungsabläufe dieser beiden Filme mit der Realität in etwa so viel zu tun hatten, wie ein moderner Lamborghini mit einem stilvollen Auftritt. Es waren, wie schon gesagt, weiterhin standardisierte Erzählungen, aber es war offenkundig, dass es den Filmemachern trotz verbesserter Filmtechniken zunehmend schwer zu fallen schien, die im Motorsport-Millieu herrschenden Regeln und Zwänge ernst zu nehmen.
Na gut, Beispiele für dieses Unvermögen finden sich auch bei fest in der Filmwelt verankerten Marken, z.B. wenn „Biologen“ auf einem fremden Planeten ihnen unbekannte Flora und Fauna ohne Handschuhe berühren (Alien-Covenant / 2017) und unbekannte Artefakte ohne Atemschutz untersuchen (Prometheus / 2012). „Schau mal… was ist das denn?“ „Huch… ich habe.. hust… hust, hust, hust!“.

Nur wenige Filmemacher trauten sich konsequent, das Genre ihres eigenen Filmes ernstzunehmen und dieses Laissez Faire betraf bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch die Produktion von Motorsport- oder Rennfilmen. Diese Nachlässigkeiten wurden sogar noch sichtbarer, wenn einem Film reale Personen oder reale motorsportliche Ereignisse zugrunde lagen. Selbst die Verwendung von Originalfahrzeugen war längst kein Garant mehr für einen in jeder Hinsicht überzeugenden Motorsportfilm. Und doch gab es in der Vergangenheit interessante filmische Genre-Hybriden, beispielsweise aus Romanze und Motorsportfilm. Um so etwas zu finden, müssen wir aber wieder etwas in der Zeit zurückreisen, genauer gesagt schon wieder in das Jahr 1969. In diesem Jahr erschien James Goldstones Rennfahrer-Melodram Winning (in Deutschland besser bekannt als Indianapolis) mit Paul Newman, Joanne Woodward und Robert Wagner. Für das zusätzliche Maß an Authentizität spielten die beiden Indy500-Rennfahrer Bobby Unser und Dan Gurney mit und natürlich bekam man auch hier originale Indy500-Rennwagen zu sehen, z.B. Eagle T1G, Vollstedt, Mongoose, sowie Lola T70 und McKee Sportwagen. Für Paul Newman war die Ausstattung wohl authentisch genug, denn er begann nach diesem Film eine zweite Karriere als Rennfahrer. Und das durchaus mit Erfolg. Nur acht Jahre später, im Jahre 1977, erzielte er zusammen mit Milt Minter und Elliott Forbes-Robinson bei den 24 Stunden von Daytona den fünften Gesamtrang (Klassendritter!) auf einem privat eingesetzten Ferrari 365 GTB/4 Competizione Conversion (Fahrgestellnummer #14437). Bei den 24 Stunden von Le Mans 1979 fuhr er, zusammen mit Rolf Stommelen und Dick Barbour, mit einem Brumos-Porsche 935 (Fahrgestellnummer #009 00030) dann sogar auf den zweiten Platz im Gesamtklassement, bevor Newman im Jahre 1983 Mitbesitzer des erfolgreichen Newman-Haas Racing Teams wurde. Diese Resultate waren weit jenseits dessen, was man noch als reines Hobby eines Schauspielers hätte abtun können.
Und mal ehrlich: Man stand in der Startaufstellung irgendeines Rennens und im Fahrzeug neben einem saß niemand geringerer als Paul Newman?

Ein weiterer interessanter Genre-Hybrid aus Romanze und Motorsportfilm erschien im Jahr 1977:
Das inzwischen fast schon vergessenen Rennfahrer-Melodram Bobby Deerfield von Regisseur Sydney Pollack. Hierin besuchte der titelgebende Rennfahrer Bobby Deerfield (Al Pacino) einen verunglückten Rennfahrerkollegen im Krankenhaus, haderte fortan mit seiner eigenen Sterblichkeit und verliebte sich in dessen Frau Lilian (Marthe Keller). Innerhalb dieses Film-Rennzirkus war Deerfield der Fahrer eines 1976er Brabham-Alfa Romeo BT-45, mithin eines originalen Formel 1-Rennwagens. Und er nutzte m.E. sogar den Helm des echten Formel 1-Rennfahrers Carlos Pace. All diese Details halfen der Glaubwürdigkeit und der Positionierung der Hauptfiguren innerhalb der Geschichte immens. Ob Pacino diesen Formel 1-Wagen dann auch wirklich fuhr, war irrelevant.
Als Renn-Romanzen positioniert, waren Winning aka Indianapolis und Bobby Deerfield sicherlich nicht jedermanns Sache, aber immerhin tappten diese beiden Hybriden nicht allzu sichtbar in die Falle der unglaubwürdigen Darstellung eines Rennbetriebes.

Mitte der 1990er Jahre, also ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Ferrari-Rennwagen auf Auktionen Mondpreise erzielten, versuchte der Musiker Chris Rea, die Lebensgeschichte des deutschen Ferrari-Werksfahrers und Idols Wolfgang Graf Berghe von Trips in einen Film zu gießen und produzierte La Passione (1996) unter der Regie von John B. Hobbs. Wissend, dass ihm das Geld für den Ankauf der benötigten echten Rennwagen fehlen würden, ließ Rea jeweils die Reproduktion eines Ferrari 156 F1 Sharknose und eines Ferrari 250TRI/61 anfertigen. Eine gute Entscheidung, denn von den neun gebauten 156 F1 hatte kein einziges Originalfahrzeug überlebt und vom TRI gab es überhaupt nur zwei originale Exemplare (Fahrgestellnummern #0792TR61 und #0794TR61), die aber bereits seit Jahrzehnten in den langjährigen und nichtöffentlichen Kunstsammlungen von Ralph Lauren („Polo“!) und von Peter Sachs („Goldman&Sachs“) standen. Selbst als Leihgabe hätte die Versicherungssumme des/ der Originalwagen alle Rahmen gesprengt. Mochte der fertige Film zwar auch vielleicht nicht ganz so überzeugend gewesen sein, kamen hier aber immerhin erstmalig Rennwagen-Reproduktionen ins Spiel, die man auch heute noch als durchaus gelungen bezeichnen könnte.
Weitere acht Jahre dauerte es, bis das Motorsport-Biopic Enzo Ferrari (2002/ Carlo Carlei) mit Sergio Castellitto und Pierfrancesco Favino erschien. Dieser Film litt etwas unter seinem sichtbar geringem Budget, einem Mangel an echten Fahrzeugen und leider auch dem Mangel an einer mitreißenden Atmosphäre. Ohne ihn diskreditieren zu wollen, bot er aber eine kleine liebevolle Geschichte und war somit wohl das, was man einen „kleinen“ Film nennen würde.
Ein Jahr später erschien die Comic-Verfilmung Michel Vaillant (2003/ Louis-Pascal Couvelaire), u.a. mit Jean-Pierre Cassel und Diane Kruger, welcher im Jahre 2002 teilweise während der echten 24 Stunden von Le Mans gedreht wurde. Für die Darstellung des „Vaillant“-Rennwagens nahm man einen echten blauen Lola B98/10 Judd und auch der „Leader“-Rennwagen wurde von einem ebenso echten rot/schwarzen Panoz LMP-1 verkörpert.

Die Art und Weise wie die Rennszenen gefilmt wurden, entsprachen der aseptischen und kalten Werbeästhetik jener Jahre, konnten sich aber sehen lassen. Und auch die restlichen gezeigten Automobile (u.a. Pagani Zonda C12!) überzeugten. Sicherlich war dieser französische Film kein dramaturgischer Weitwurf, aber er kam so unerwartet, dass ich ihn damals ganz in Ordnung fand. Vielleicht lag es aber auch an der Wiederbelebung meiner Erinnerung an die Zack-Comics oder auch daran, dass Teile des Filmes in der Nähe von Aubusson auf der sehr privaten(!) Rennstrecke am Schloss Mas du Clos des Ferrari-Sammlers Pierre Bardinon gedreht wurden und der Film bot immerhin einen der seltenen Einblicke in diesen Privatbesitz.
Der im Jahre 1967 spielende Film Flash of Genius (2008) des Regisseurs und Filmproduzenten Marc Abraham (Children of Men / 2006; Regie: Alfonso Cuarón) war hingegen von einer Comic-Verfilmung weit entfernt und beleuchtete faktenbasiert und durchaus spannend, den Kampf des Erfinders des Intervall-Scheibenwischers Professor Robert Kearns (Greg Kinnear) gegen die übermächtige Ford Motor Company. Weil bei diesem Film Regisseur und Produzent ein und dieselbe Person waren, konnte ein peinlicher Pitch im Vorfeld hoffentlich vermieden werden. Aber man stelle sich bitte nur mal vor, wie dieser wohl abgelaufen wäre: „Ah, sehr schön… auf diesen Filmstoff haben wir gewartet… endlich können wir den Zuschauern die spannende Geschichte über die Entwicklung des INTERVALL-Scheibenwischers nahebringen! Wir geben den Filmemachern Summe X!“. Wir lassen uns aber nicht beirren, denn für ein „Special Interest“ innerhalb eines „Special Interest“ war der Film im Look eines TV-Filmes durchaus gut.

Als „Special Interest“ konnte man auch Quentin Tarantinos „Hommage“ an die Exploitation-/ Grindhouse-/ B-Movies der 1970er Jahre bezeichnen: Der Film Death Proof – Todsicher (2007) war für mich als Kind der 1970er Jahre leider nicht konsequent genug und nervte durch seine gekünzelte Schwafeligkeit, die nicht so richtig zu dieser Ära passen wollte. Die Form war zwar interessant (künstlich hinzugefügte Kratzer, Alterungs- und Abnutzungsspuren auf dem Filmmaterial, „Missing Reel“-Texttafel u.v.m.), konnten mich nicht wieder einfangen. Zum Grinsen brachte mich einzig das Kennzeichen „JJZ 109“ an Kurt Russells Chevy Nova. Warum, erklärt sich im Verlauf dieses Textes noch.
Aber moderne Highgloss-Filme sin bekanntlich auch kein Garant. In der seit 2001 laufenden The Fast and the Furious-Filmreihe entfernten sich bis heute die Fahrzeuge immer weiter von einer physikalisch korrekten Darstellung und machten längst der Selbstdarstellung und dem Style der Protagonisten Platz; nun waren es Sepia-gefilterte Action-Inhalte, die Unterhaltung um der Unterhaltung Willen auf die Leinwand rotzten. Ähnlich derer, wie es auch die Action-Filmreihe Transformers (seit 2007) anbot. Sicherlich ist es da nur rein subjektiv, aber selbst den Film Monster Trucks (2016 / Chris Wedge), in welchem sich das subterrane Tentakelwesen Creech in einem 1955er Dodge C3 Pickup versteckte, fand ich weitaus unterhaltsamer als beide Filmreihen zusammengenommen. Deutete sich da etwa eine Zunahme an Ernsthaftigkeit in den Erzählungen an? Nein, zu früh gefreut. Der kurz danach erschienene Film Overdrive (2017 / Antonio Negret) mit Scott Eastwood machte auf dem Terrain der Autofilme leider schon wieder etwas weniger Boden gut, bot unter dem Strich aber immerhin hübsche Fahrzeug-Reproduktionen, die dann wenigstens forciert gefahren und abgefilmt wurden.

Ernsthaftigkeit bekam man zu dieser Zeit in Deutschland, wenngleich wir es hierbei immer mit reinen TV-Produktionen zu tun hatten/ haben. Nun ging es um einen Kollateralschaden im deutschen Wirtschaftswunder und der Film bediente sich einmal mehr der Geschichte Davids gegen Goliath. Der Regisseur Marcus O. Rosenmüller zeigte in seinem Dokudrama Die Affäre Borgward (2018) den verzweifelten Kampf des Bremer Automobilpioniers Carl F.W. Borgward, dessen moderne Fahrzeugkonzepte ihrer Zeit (einmal mehr) um Jahrzehnte voraus waren. Und erneut waren es skrupellose Konkurrenten, die den Mitbewerber mit einer Diffamierungs-Kampagne diskreditierten und schließlich ebenfalls in den Bankrott trieben.
Große Teile des Lebens der realen Hauptfigur einsparend und deshalb nur kleine Teilaspekte seines Lebens ausleuchtend, erschien dann vor Jahresfrist der Film Lamborghini-The Man behind the Legend (2023 / Bobby Moresco) mit Frank Grillo. Auch dieser Film litt leider an einem sichtbar begrenzten Budget und an fehlender erzählerischer Dynamik. Etwas, was leider auch auf den Film Gran Turismo (2023 / Neill Blomkamp) zutraf. Trotz Jann Mardenboroughs unglaublich interessanter Lebensgeschichte wollte der Funken bei mir nicht so recht überspringen. Das war ärgerlich, denn zuvor hatte ich im linearen Fernsehen bereits die mehrstündige Dokumentation über das erste Auswahlverfahren der Nissan -GT-Academy gesehen. Die Teilnehmer dieser Academy mussten sich in einem heftigen Auswahlprozedere dem Ziel stellen, ihre an der Playstation erlernten Fähigkeiten auf einen echten Rennwagen zu übertragen und mit diesem dann siegfähig zu sein. In der Realität! Und Mardenborough konnte sich gegen unfassbare 90.000 Mitbewerber durchsetzen.
Wahrscheinlich von der Angst getrieben, die Playstation-Jünger zu verschrecken, entschieden sich die Filmemacher aber leider für die ultraglatte Ästhetik des gleichnamigen Konsolenspieles und übersahen, dass sie eine reale(!) Erfolgsgeschichte erzählen wollten. Wo das Problem ist? Nun, in der Realität gibt es nun mal keine glatte Videospiel-Ästhetik. Oder erkennt hier noch jemand den Unterschied? Filmszene oder Videospielszene?

Natürlich ist es rein subjektiv, aber das Resultat wollte dem echten Mardenborough und seiner Geschichte nicht ganz gerecht werden. Vielleicht habe ich mit zunehmendem Alter auch nur eine Aversion gegen optische Brillanz. Aber selbst, wenn man die Videospiel-Ästhetik hinnehmen würde, fiel auch hier schon wieder etwas auf: Nämlich, wie schwer sich auch gute Regisseure damit tun, einen Rennbetrieb mitreißend und authentisch zu inszenieren. Das ist insofern bemerkenswert, wenn man dann auch noch die zur Verfügung stehenden technischen Mittel der Gegenwart in die Waagschale wirft, auch das sprach ich ja schon an. Ich kann da nicht aus meiner Haut. Es wirkt auf mich einfach so, als würden Autoren oder Regisseure der Strahlkraft ihrer eigenen Geschichte nicht vertrauen. Vermutlich ist die Wahrheit aber viel banaler: Bei der Produktion von Filmen geht es längst darum, wie wenig finanziellen und technischen Aufwand man betreiben, und dennoch Profit an der Kinokasse erzielen kann? Das Problem solcher Überlegungen ist, dass hierbei nur faule Kompromisse herauskommen. Es ist ein wenig so, als wenn sich durchschnittliche Fahrer auf die elektronischen Fahrhilfen ihres Fahrzeuges verlassen und hoffen, dass es durch diese Helferlein weniger auffällt, wie wenig sie sich für den Vorgang des Fahrens interessieren, wie schlecht sie einparken oder Abstände einhalten können, meint: Dass sie mies Auto fahren! Das bedeutet: Immer, wenn solche Filme formal etwas zu „clean“ sind, ich erwähnte es ja bereits, muss man genau hinschauen. Es könnte nämlich nur eine weitere Nebelkerze sein, die von der ungenügenden Storyentwicklung ablenken soll. Obwohl… zu den Storyentwicklungen moderner Filmprodukte fallen mir inzwischen eher die Termini „uninspiriert“ und „gelangweilt“ ein. Zum Vergleich: Selbst der computeranimierte Pixar-Film Cars (2006/ John Lasseter) war in der Handlung und in der Darstellung von Rennabläufen inspirierter, als so manch real gefilmtes Vehikel. Wenn also selbst bei einem renninteressierten Zuschauer wie mir beim Schauen eines moderneren Rennfilmes nichts überspringt, dann kann es natürlich entweder an meinem Hirntod liegen, meiner Übersättigung oder ich wurde über Jahre hinweg Zeuge, wie sich die erzählerischen Maßstäbe immer weiter abgesenkt haben.
Bestätigt wurde dieser Eindruck auch durch eine kürzlich veröffentlichte Charakterstudie, die zum Glück immer dann besser wurde, wenn es nicht um den titelgebenen Namen, sondern um das Drama seiner Rennfahrer ging. Die Rede ist vom Amazon-Film Ferrari (2023) von Michael Mann mit Adam Driver und Penelope Cruz. Ausschließlich im Jahr 1957 angesiedelt, war dieser Film definitiv kein Biopic, auch wenn er als solches angepriesen wurde. Als wirklich schlimm empfand ich aber, dass die Autoren zugunsten einer für den Film benötigten Dramaturgie an eigentlich sehr klar überlieferten Details historisch verbriefter Vorgänge herumgeschraubt hatten. Während hier die menschlichen Darsteller über Routinearbeit nicht hinauskamen, wurde der Film ansteigend besser, wenn er sich auf das Renngeschehen konzentrierte. Vielleicht hätte man nach einer imaginären Spielzeit von sechs Stunden also endlich Perfektion sehen können. Leider war er dafür dann doch zu kurz. Immerhin bot der Film durchweg überzeugende Ferrari 315S/335S- und Maserati 350S/ 450S-Nachbauten. Nicht nur aufgrund der historischen Signifikanz und der daraus resultierenden Werte der Originalfahrzeuge, war das ein absolut notwendiger Move, aber das habe ich ja schon an anderer Stelle ausführlich ausgebreitet. Bei 40 Millionen Dollar plus X alleine für den Ankauf des originalen Siegerfahrzeuges mit der Startnummer „535“ hätte es das zur Verfügung stehende 95 Millionen Dollar Budget nun wirklich zerrissen. Abgesehen davon, dass dieser gar nicht zum Verkauf stand. Und überhaupt: Womit hätte man eigentlich die anderen benötigten Wagen finanziert?

Bei der Suche nach Filmen, in denen automobile oder motorsportliche Vorgänge weitestgehend korrekt wiedergegeben wurden, darf deswegen auch Ron Howards Film Rush – Alles für den Sieg (2013) mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth nicht fehlen. Motorsportinteressierte Zuschauer hatten ja schon etwas länger Filme über epische Rennstreckenduelle erwartet und hier ging es nun
um das längst legendäre Formel 1-Duell von Niki Lauda und James Hunt. Auch, wenn es Quellen gibt, die das Gegenteil behaupten: Für die Fahraufnahmen benutzte diese Produktion keine Originalfahrzeuge, sondern Ferrari– und McLaren Formel 1-Reproduktionen, in diesem Fall auf der Basis von Mygale Formel Ford-, sowie Formel Renault-Fahrgestellen. Unter dem Strich machte der Film letztlich aber wirklich Spaß, wenngleich das Prädikat des insgesamt „rundesten“ neuzeitlichen Motorsportfilmes der letzten Jahre aber an Le Mans ’66 – Gegen jede Chance aka Ford vs. Ferrari (2019/ James Mangold) mit Christian Bale und Matt Damon ging. Dieser Film erfreute den Filmfreund nicht nur mit einer nahbaren und unterhaltsamen Erzählung, sondern den Motorsportfreund auch mit sehr gut nachgemachten Superformance–Cobra Daytona Coupes, sowie Ford GT40- und Ferrari P3-Nachbauten von Race Car Replicas/RCR, die alleine insgesamt satte achtundzwanzig Nachbauten an die Filmproduktion lieferten. Überrascht war ich aber über kleine eingestreute Details. Den geschulten Falkenaugen eines Fachidioten wie mir, konnten bei einem Kameraschwenk doch tatsächlich einen korrekt gegliederten Ford MkII Motorennummern-Suffix (#AX.316.1.xx) auf den Ventildeckeln eines Ford GT Mark II 427cbi V8 Motors erkennen, wtf!
Eine wirklich liebevolle Geste für die wenigen Nummernspezialisten unter den ZuschauerInnen.
Natürlich war der Film weit davon entfernt, perfekt zu sein. So gab es ein paar Fauxpas‘ bezüglich der Timeline der geschichtlichen Ereignisse und weitere Fauxpas‘ bezüglich der am 1966er Le Mans Rennen teilnehmenden Fahrzeugtypen, wodurch es natürlich kleine Probleme mit den zugeteilten Startnummern gab, und ja, vielleicht gab es auch einen in einem effektvollen CGI-Feuerball verunfallenden Wagen zuviel, aber herrjeh… alleine dieses kleine Detail auf dem Ventildeckel reichte aus, um den Film in meine Rennbenzin-Gebete einzuschließen. So, und nicht anders, holt man das Fachpublikum mit ins Boot.

Und wo wir übrigens gerade beim Thema sind: Während des laufenden politischen Hickhacks bezüglich eines mal mehr, mal weniger konkreten Endes der Zulassungsfähigkeit von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035, wartet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes bereits ein weiterer Motorsport-Film auf eine Verwertungsform. Endlich würde sich ein Film mal mit den Anfängen der mörderischen, filmisch bisher aber sträflich vernachlässigten, Gruppe B Rallye-Ära beschäftigen: In dem Film Race of Glory: Audi vs. Lancia (2024) aka 2 Win von Stefano Mordini spielt Daniel Brühl den Ingenieur Roland Gumpert, welcher in der der Realität zunächst für den zuschaltbaren Allradantrieb des für die Deutsche Bundeswehr entwickelten hochbeinigen VW Iltis zuständig war, bevor dessen Allradantrieb in einem unglaublichen Techniktransfer an Audi weitergegeben wurde. Als Rennleiter für Audi Sport konnte Gumpert dann viermal den Rallye-Weltmeistertitel holen, wobei verschiedene Versionen des Audi Quattro eingesetzt wurden.
Der Knackpunkt ist: Weil inzwischen die Leistungsfähigkeit komplett neu aufgebauter Gruppe B-Rallyefahrzeuge die Leistungsfähigkeit damaliger Gruppe B-Wagen inzwischen weit übersteigt, hängt die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft des Filmes schon jetzt an der Art und Weise, wie forciert jene Audi Quattro und Lancia Rally 037 bewegt, und wie dramatisch sie dabei gefilmt werden. Ein ultraschwieriges Thema, denn weil ich diese Ära (als Zuschauer) mitbekam, und die dabei entstandenen Gefühle konserviert habe, möchte ich respektvoll auf den weißen Elefanten im Raum hinweisen: Gäbe es generell überhaupt irgendeinen(!) filmischen Weg, wie man der Gruppe B gerecht werden könnte? Kann ein Film, der ja immer auch ein Kompromiss ist, den absolut(!) kompromisslosen Wahnsinn dieser Ära rüberbringen? Ihr wisst nicht, was ich meine? Gut, dann eine kleine Erinnerung:

Die große Frage ist bei Rennfilmen also immer dieselbe: Wie authentisch kann ein Film in der Darstellung der Realität überhaupt sein? Immerhin betraf diesbezügliche Glaubwürdigkeit im Detail auch schon Ikonen dieses Genres, wie man auch am Beispiel des nach heutigen Maßstäben immer noch großartig gefilmten Spektakels Grand Prix (1966) von John Frankenheimer ablesen konnte. Da auch dieser Kultfilm Filmmaterial von echten Formel 1-Rennen beinhaltete, wurden eigentlich eine Menge originaler Formel 1-Rennwagen benötigt, um Anschlussfehler zu vermeiden. Die Produktion traute den Schauspielern aber nicht so recht zu, echte Formel 1-Rennwagen im Renntempo zu bewegen, obwohl gerade Hauptdarsteller James Garner fachlich dazu durchaus in der Lage gewesen wäre. Die Intervention der Produktionsversicherung tat ihr Übriges und so behalf man sich mit Formel 2- und/oder Formel 3-Fahrgestellen von Williams&Pritchard, die mit 4-Zylinder Reihenmotoren und nur einem Liter Hubraum ausgestattet waren.
Für einen etwas glaubwürdigeren Formel 1-Auftritt schweißten die Set-Techniker diesen Wagen Achtzylinder-Auspuffgekröse und falsche Vergasertröten an, um die Anwesenheit von 3 Liter Formel 1 V8 Motoren zu suggerieren. Zusätzlich kamen Abdeckungen aus Plastik zum Einsatz, um die sehr viel kleineren Motoren zu kaschieren. Gut, da Formel-Rennwagen nicht mein Fachgebiet sind, verweise ich auf Quellen, die diese Details schon an anderer Stelle und sehr viel besser aufgedröselt haben. Mir waren diese „Hybriden“ erst auf den zweiten Blick aufgefallen, aber die vereinzelt schneller abgespielten Rennsequenzen waren dafür kaum zu übersehen. Besänftigend wirkte sich aber der Einsatz zweier originaler(!) Ford GT40 mit den Fahrgestellnummern #1018 und #1027 aus, welche zum Kameraträger umgebaut worden waren. Beide Wagen waren im Besitz der Metro–Goldwyn–Mayer und wurden bei den Grand Prix-Dreharbeiten von niemand Geringerem als dem 1961er Formel 1-Weltmeister Phil Hill gefahren.
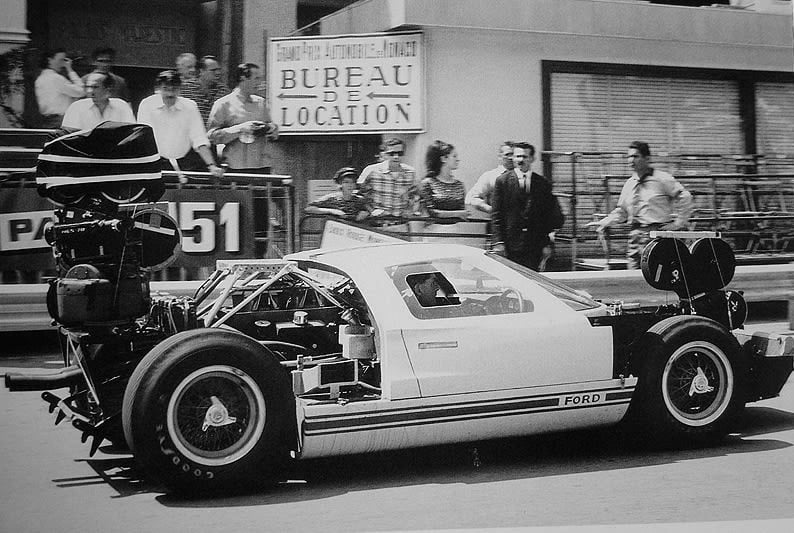
Fun-Fact: Bei den Dreharbeiten auf dem Rennkurs von Monaco konnte Phil Hill mit diesen schweren Kamera-GT40 sehr viel schneller fahren als die extrem leichten F2/F3-Wagen, die man zum Formel 1-Fahrzeug umgestaltet hatte. Für Action-Rennaufnahmen, u.a. auf der echten Rennstrecke von Monza, lieh man sich eine originale Shelby Cobra 427 Competition mit der Fahrgestellnummer #CSX3014 von Ford Advanced Vehicles / FAV in Slough, England und setzte einen unerschrockenen Kameramann auf den heißen Stuhl.
Dass man Originalfahrzeuge hier hauptsächlich „Off Screen“ sah, tat der Legendenbildung von Grand Prix zwar keinen großen Abbruch, aber manchmal wüsste ich schon gerne, ob eine Ausstattung komplett mit originalen Formel 1-Rennwagen und ohne schneller abgespielte Szenen beim filmhistorischen Standing dieses Filmes heute noch einen Unterschied machen würde. Nochmal zur Erinnerung: In diesem Artikel geht es auch darum, dass Authentizität letztlich durch nichts zu ersetzen ist. Also können jegliche Bemühungen um eine authentische Darstellung in einem Film gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Soweit die Theorie, denn leider sorgen immer wieder Nachlässigkeiten, sowie begrenzte Budgets und die Verwässerungen von Inhalten zugunsten der Erreichbarkeit breiterer Publikumsschichten dafür, dass Fans des jeweiligen Genres vor den Kopf gestoßen werden. Ausgerechnet jene Zuschauergruppen also, die durch ihre Expertise die fachliche Qualität eines (Motorsport-) Genrefilmes einordnen könnten (und können). Eigentlich ist es paradox, denn man sollte doch annehmen, dass auch Motorsport-Filme für möglichst alle Zuschauergruppen gedreht werden. Also inklusive der Freunde und Fans des Motorsports!
Ein kleines Beispiel aus einem anderen Genre: Guy Hamiltons Weltkrieg II-Epos Luftschlacht um England (1969) zeigte in seinem Genre-Rahmen, wie wichtig eine gute Vorbereitung, technisches Verständnis und historische Genauigkeit ist. Um dieses Ziel zu erreichen, ließ die Produktion sich nicht lumpen und schaffte insgesamt 27 originale Supermarine Spitfires (davon 12 flugfähig) und 6 Hawker Hurricanes (3 flugfähige Exemplare) an.

Für die Darstellung der Deutschen Luftwaffe wurden zusätzlich 27 Stück HA-1112 und 32 Sück CASA 2.111 gekauft, spanische Lizenzbauten der für die Aufgabe des Angriffs auf England benötigten deutschen Messerschmitt BF 109 G-2 und Heinkel HE 111 H16.
Knapp ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende war es sicherlich eine Herausforderung, so viele originale Warbirds zusammenzusuchen, zu restaurieren und wieder flugsicher zu bekommen aber dieser Aufwand hat sich mehr als nur gelohnt und das Resultat war die absolute Glaubwürdigkeit bei der titelgebenden Aufgabe. Zugegeben, bei der genauen Darstellung von Luftkämpfen drohte in diesem Film eher keine Verwässerung der Handlungsumgebung in eine selbstzweckhafte Kulisse: Der Himmel über den Kreidefelsen von Dover war einfach über jeden Zweifel erhaben und alte Militärflugplätze standen in England auch 1968/69 immer noch in ausreichend großer Anzahl zur Verfügung. Dieser Film war beispielhaft dafür, wie man es richtig macht.
Wir halten also schon mal fest: Für eine Filmproduktion, die ernstgenommen werden will, wäre die Akquise von Originalmaterial und die Verwendung von Originalschauplätzen das oberste Gebot. Auf Platz Zwei: Die Beteiligten sollten mit der Requisite eine Bedienungssicherheit herstellen und eine nahezu symbiotische Beziehung eingehen. Ungefähr so, wie es seinerzeit Peter Falk aka Inspektor Columbo (1968-2003) machte. Nachdem er sich zu Beginn der Dreharbeiten 1967/68 seinen Dienstwagen auf einem Parkplatz für ausrangierte Requisiten ausgesucht hatte, und in dem Peugeot 403 Cabriolet in der hinterletzten Ecke dieses Platzes, den am wenigsten glamourösen Wagen erkannte, wusste er: In diesem Wagen würde seine Rolle maximal unterschätzt werden.
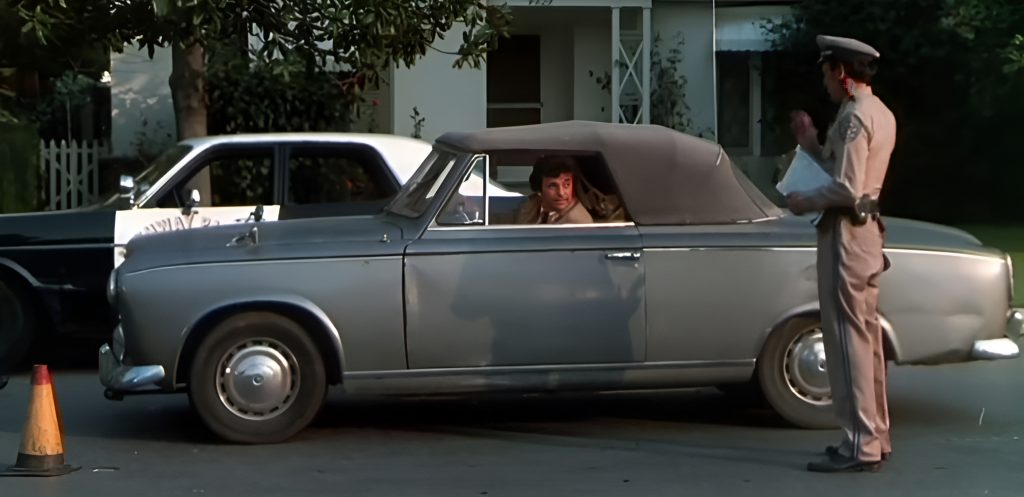
In diesem Zusammenhang ist es recht interessant, dass US-amerikanische TV-Serien weitestgehend von den progressiven Erzählungen des „New Hollywood“ verschont geblieben sind. Das Fernsehen blieb bei der reinen Unterhaltung und im Kino gab man sich dem existenzialistischen Fatalismus hin. Das war bemerkenswert, weil beide Formen ja eigentlich im selben Einflussbereich und in derselben Ära koexistierten, quasi direkte Nachbarn waren. In der Nachbetrachtung macht es deshalb auch fast den Anschein, als hätte man es mit separaten Welten zu tun. Dazu kommt: Je mehr eine TV-Produktionen zeigen wollte, desto mehr war sie wegen des weitaus geringeren Budgets in Gefahr, das Falsche zu zeigen.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch gut an ein besonders beliebtes Motiv, das die alten Krimiserien vom Schlage eines Detektiv Rockford (1974-1980), Petrocelli (1974-1976) oder Delvecchio (1976-1977) immer wieder benutzt hatten. In diesem Beispiel saß der zukünftige Klient meist entweder in einem untermotorisierten Wagen oder in einem europäischen Exoten, z.B. einem Jaguar E-Type, wenn er bemerkte, dass er verfolgt wurde. Gedreht wurden diese Außenaufnahmen meist auf dem Mulholland Drive oder dem Laurel Canyon in den Hollywood Hills, kostengünstig und in direkter Nachbarschaft zu den Studios.
In der Hektik verlor der Gejagte dann, gerne in einer engen Kurve, die Kontrolle über seinen Jaguar und schleuderte mit quietschenden Reifen und panisch aufgerissenen Augen auf den Rand der Klippe zu… Schnitt… die im Tal positionierte Kamera filmte, wie ein alter Volvo-Kombi über die Klippe geschoben wurde (nicht fahrend!) und in den Abgrund fiel, wo er völlig zerschmettert wurde. Lassen wir mal beiseite, dass die Wagen auch mal während des Absturzes völlig grundlos explodierten, fanden hierfür hauptsächlich „Empty shells“ Verwendung, d.h. originale Fahrzeughüllen und später sogar komplette Fahrzeugrepliken, um die teuren Originalfahrzeuge nicht zu beschädigen. Wegen der Budgets verständlich. Aber eine andere Fahrzeuggattung? Beim Film hatte man zur selben Zeit das Geld offenbar übrig und kannte keine Scheu, auch europäische Exoten zu beschädigen. Das Bild zeigt die Unterseite eines originalen, aber verunfallten Jaguar E-Type Roadster bei den Dreharbeiten zu dem Film Fluchtpunkt San Francisco.

Gut, soviel Ausführlichkeit bis hier. Das war schon mal recht anstrengend, aber es war ja auch eine Menge an Informationen. Man könnte auch sagen, dass dies weitestgehend jene Filme waren, die man zu schauen hatte, wenn man sich für das Thema Automobil und/ oder Motorsport interessierte. Diese Filme bieten uns etwas Orientierung und man mag mir bitte nachsehen, falls hier ein paar Lieblings-Autofilme oder Lieblingsserien der LeserInnen nicht genannt wurden.
Nun ist es aber Zeit für den Ernst des Lebens, d.h. wir klappen die Fühlerlehre aus, überprüfen das Ventilspiel und setzen den Schraubendreher ans Ohr. Oder, für die jüngeren LeserInnen: Wir werden die OBD 2-Schnittstelle suchen, um sich ausführlicher mit dem absoluten Highlight dieses Themenspektrums befassen. Einem Film, bei welchem dem Hauptdarsteller, der auch Co-Produzent des Filmes war, offensichtlich nicht egal war, welche Details und welche Abläufe die Zuschauer auf der Leinwand zu sehen bekommen.

Aus der Sicht eines Freundes des historischen Motorsports ist der Film Le Mans bis heute ein Tritt in den Hintern von so manch modernem Automobil- oder Rennsportfilm. Das verwundert nicht, denn Steve McQueen hatte diesen Film ja ursprünglich als Dokumentation geplant, weswegen es ausschließlich die Zwänge, Umstände und Realitäten exakt dieses Rennens waren, welche das Timing, den Inhalt, und den professionellen Handlungsrahmen vorgaben. Der Hauptdarsteller und Co-Produzent hatte alles darangesetzt, alle Filmideen, die nichts mit einem geordneten Rennablauf auf dieser Rennstrecke zu tun hatten, als Fremdkörper aus dem Drehbuch zu entfernen.
Das hatte Folgen, denn inzwischen vermengten sich Bilder aus diesem Film sogar fast unbemerkt mit den Bildern des echten(!) Rennens. Wenn man beispielsweise bei der Bildersuche einer Suchmaschine „Le Mans 1970“ eingibt, könnte ein Rennsport-Laie anhand der angezeigten Bilder kaum noch erkennen, ob sie während des echten Rennens entstanden sind oder ob sie nicht sogar irgendeine Szene aus dem Film abbilden. Fehlt dann noch die Bildunterschrift, ist es sogar nahezu unmöglich. Tatsächlich ist der Film Le Mans in seinen Details so präzise, dass man für das Erkennen dieser Unterschiede profunde Kenntnisse des originalen Rennens, ein Verständnis der verwendeten Startnummern und des Filmes selbst benötigen würde. Die Tatsache, dass der Film nur einen ganz bestimmten Tag im Jahre 1970 konservierte, ließ ihn nicht nur sehr gut altern, sondern lässt ihn nur noch zeitloser erscheinen… ja, es erscheint heute sogar manchmal so, als ob es in jenem Jahr zwei Rennen in Le Mans gegeben hätte.
Den wenigsten Lesern dürfte es daher in letzter Konsequenz bewußt sein, dass es für die Evolution des Filmgenres „Automobil- und Rennsport“ eine echte Katastrophe war, dass dieser Film bereits vor über einem halben Jahrhundert die Leinwände dieser Welt eroberte.

Dabei war das herausstechendste Merkmal dieses Filmes ganz offensichtlich. Damals setzte man einfach superteure, hochaktuelle und originale Rennwagen für die Aufnahmen ein, am besten jene, die schon im echten Rennen mitgefahren waren. Und in besonders heiklen Situationen ließ man sie einfach von etwas weniger teuren, dennoch aber ebenfalls originalen Rennwagen doubeln. Man stelle sich mal vor, was das heute für eine Dekadenz wäre. Die Risikoträgheit der Filmstudios in Verbindung mit inzwischen Multi Millionen Dollar teuren Fahrzeugen und ihren explodierenden Versicherungsprämien, sowie den verschärften Umwelt- und Lärmvorschriften an den Rennstrecken dieser Welt, hatten jedoch zur Folge, dass alle seither gedrehte Rennsport- und Motorsportfilme mit etwas weniger von Allem auskommen mussten. Aber auch die inzwischen sehr viel bessere Kameratechnik mit einer höheren Schärfe, Brillanz und Auflösung, sowie der weltweite Trend zur LED Wall-Rückprojektionstechnik für die Hintergrund-Action, konnte diesen Trend zu weniger Ausstattungsqualität nicht mehr aufhalten.
Damals waren sich die Le Mans Kinozuschauer des hohen Niveaus der Aufnahmen, der originalen Rennwagen und dem Ausmaß an erzählerischem Realismus in Ermangelung vergleichbarer Filme wahrscheinlich noch nicht bewusst. Mehr noch. Es scheint, als hätten Rennsportenthusiasten und Kinogeher ihre Freizeiten immer separat voneinander verbracht. Während die Motorsportfans vor fassungslosem Erstaunen im Motorsporthimmel waren, wussten durchschnittliche Kinogeher kaum etwas mit dem 24-stündigen Spannungsaufbau eines Langstreckenrennens anzufangen, welcher in einem 104-minütigen Film komprimiert wurde. Aber wahrscheinlich konnten sie auch dem Unterhaltungswert des Schalldrucks in der Magengrube nichts abgewinnen, wenn auf der Hunaudières-Geraden eine Schwadron Porsche 917 und Ferrari 512S mit Geschwindigkeiten zwischen 340km/h und angenäherten 390km/h vorbeibrüllte. Aldous Huxley hatte eindeutig Recht als er schrieb, dass der moderne Mensch mit der Lust nach Geschwindigkeit nur ein einziges neues Laster erfunden hatte.

Es scheint also gesetzt zu sein: Durch seinen fiebrigen Realismus setzte Le Mans einen so großen Meilenstein, dass er trotz moderner Filmtechnik und verbesserter Ton- und Aufnahmequalitäten bis heute nicht übertroffen werden konnte. Das muss ein Film erst einmal schaffen. Alle vergangenen und alle künftigen automobilen Rennsport- und Motorsportfilme werden sich an diesem Peak messen lassen müssen.
Und hier beginnen dann auch schon die Probleme: Denn welche Informationen könnte es überhaupt noch geben, die nicht schon längst mehrfach publiziert worden wären? Selbst, wenn man, so wie ich, ein Faible für Automobilforensik und die Historien automobiler Renn-Skulpturen hat und eine grundsätzliche Bereitschaft mitbringt, mit Hirn, Herz, Bauch und Lupe an einen individuellen Rennwagen heranzugehen?
Seit dem Erscheinen des Filmes Le Mans sind über 50 Jahre vergangen, der Inhalt wurde mehrere tausend Male niedergeschrieben, von aktiven und ehemaligen, von beteiligten und unbeteiligten Rennfahrern, Mechanikern, Restauratoren, Händlern, sowie RedakteurInnen, AutorInnen, SchauspielerInnen, Film- und AutomobilhistorikerInnen. Die wenigsten von ihnen sind dem Hauptdarsteller Steve McQueen je begegnet, ich zuallerletzt. Da ist es doch erst einmal verlockend leicht, das klassische Bild eines männlichen Hollywood-Stars der 1960er/ 1970er Jahre zu befeuern.

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Der ehemalige Chefmechaniker der Schweizer Scuderia Filipinetti, Francesco Zefferino „Franco“ Sbarro, erzählte in einem Interview, wie herzlich, liebenswürdig und warm Steve McQueen im direkten Kontakt mit Menschen war, vor allem außerhalb des Filmzirkus und unabhängig davon, ob er es mit Frauen oder Männern zu tun hatte. Aus irgendeinem Grund tat er sich mit Filmleuten etwas schwerer. Übrigens gibt es hierzu eine kleine Anekdote. Es war während der Dreharbeiten zu Le Mans, als wieder einmal alle an ihm und seinen Nerven herumzerrten und immer noch eine Frage mehr hatten. Alle, bis auf auf den deutschen Schauspieler Siegfried Rauch. Der schwieg nämlich und schaute zunächst nur zu. Das war auch McQueen nicht entgangen und so fragte er Rauch, warum er nicht mit ihm rede, ihn ignoriere, woraufhin Rauch wohl sinngemäß antwortete, er versuche nur, seine (McQueens/ ed.) Arbeitsweise, seinen Freiraum zu respektieren, seine Fokussierung einfach nicht zu stören. McQueen war schwer beeindruckt. So sehr, dass die Zwei ab diesem Zeitpunkt viel Zeit miteinander verbrachten. Hier hatte sich offenbar zwei Seelenverwandte gefunden und ich konnte kein weiteres Bild zu finden, auf dem man diese Menschenliebe deutlicher hätte sehen können.

Während der Dreharbeiten entstand also eine der seltenen Freundschaften unter Schauspielern, inklusive gegenseitiger Besuche in Hollywood und in Untersöchering, ganze Bücher wurden inzwischen darüber verfasst. So konnte man lesen, dass McQueen für die Taufe von Rauchs Sohn Benedikt nach Deutschland reiste und sich bei seinem Versuch, den Weg ins Dorf zu finden, verfuhr. In Murnau fragte er dann wohl ein Mädchen nach dem Weg, was natürlich zur Folge hatte, dass er eine halbe Stunde zu spät ankam, weil dieses Mädchen nur fassungslos seinen Namen stammeln konnte, anstatt den Weg zu beschreiben. Sollte sich dieses Mädchen von damals noch bester Gesundheit erfreuen, ist diese Erinnerung vermutlich bis heute wie von einem anderen Stern. Ich weiß, wovon ich schreibe. Es muss ungefähr im Jahre 2013 gewesen sein, als meiner damaligen Freundin in einer menschenleeren und ruhigen Seitenstraße in der mittelalterlichen Innenstadt von Lübeck der Schauspieler Willem Dafoe entgegenspazierte. Dafoe war in Hamburg mit den Dreharbeiten zu Anton Corbijns Film A Most Wanted Man (2014) beschäftigt und hatte in einer Drehpause wohl einen kleinen Ausflug nach Lübeck gemacht. Es gibt in diesem Zusammenhang einfach kaum eine surrealere Situation, als wenn ein Schauspieler mit einem weltbekannten Gesicht einem plötzlich über den Weg läuft. So lief es wohl auch in Murnau ab. Vielleicht auch, weil McQueen aus einer nicht ganz so intakten Familie kam, konnte er bei Familie Rauch in der bayrischen Provinz wohl wirklich zur Ruhe kommen. Auch in der örtlichen Gastwirtschaft.

„Er hat nie viel geredet. Aber dafür konnte man sich bei ihm auf jedes Wort verlassen!“, sagte Siegfried Rauch sehr viel später. Aber so liebenswert und umgänglich Steve McQueen im privaten Umfeld offenbar auch war, so pedantisch und perfektionistisch war er bei der Durchsetzung seiner filmischen Ideen und wenn diese mal nicht durchsetzbar waren, konnte die Gelassenheit des „King of Cool“ wohl durchaus auch mal ins Rutschen kommen. Allerdings nicht aufgrund eines übersteigerten Egos, sondern immer im Dienste eines noch besseren Resultats. Hierfür ging er in einer Mischung aus „Perfektionismus“ und „Rampensau“ an seine Rollen heran. Dies tat er jedoch nicht immer zur Freude seiner Regisseure oder Kollegen. Wenn er nämlich in kreativer Höchstform war, gehörte nicht nur ein gutes Timing, sondern durchaus auch das Lenken des Zuschauerblicks auf seine Handlungen zu seinem schauspielerischen Repertoire. Seit Generationen ist zum Beispiel seine Nebenrolle(!) in dem großartigen Film Die glorreichen Sieben (1960/ Regie: John Sturges) unvergessen. Es mag sich unfair lesen, aber während sich in diesem Film (und in den meisten anderen auch) das Repertoire des Hauptdarstellers Yul Brynner, wahrscheinlich gut gemeint und in absoluter Drehbuchtreue, weitestgehend darauf beschränkte, mit einer lässigen Zigarette zwischen den Lippen an der Kamera vorbei in die Ferne zu blicken, erfand McQueen für seine Rolle laufend und eigenständig kleine Gesten, Marotten und Details, die nirgendwo im Drehbuch zu finden waren. So wie auch das kleine Fläschchen auf dem folgenden Szenenbild.

Aber auch jene berühmte Szene auf dem Kutschbock eines Pferdefuhrwerkes, in welcher McQueen jede einzelne Patrone schüttelte und an ihr horchte(!), bevor er damit seine Schrotflinte lud, und so dem ebenfalls auf dem Kutschbock sitzenden und einmal mehr in die Ferne blickenden Yul Brynner erneut die Aufmerksamkeit des Zuschauers stahl, war auf dem Mist des Nebendarstellers gewachsen. Mit dem zweifelhaften Ergebnis, dass Brynner wegen des Aufmerksamkeitsdiebstahls während der Dreharbeiten zu diesem Film natürlich vor Wut kochte. Aber: Auch nach heutigen Maßstäben waren diese Einfälle brillante und urkomische Ideen, passten zu der Rolle und wirken tatsächlich immer noch zeitgemäß. Nichts für ungut, aber erinnert sich noch jemand an irgendeine Geste Brynners? Na eben. Die bereits weiter oben behandelte zeitgeschichtliche Timeline ließ uns verstehen, mit welcher Ära wir es zu tun haben. Hier helfen uns nun kleine Anekdoten zu verstehen, welche Persönlichkeit und welches Rollenverständnisse hier schon ein paar Jahre vor den Dreharbeiten zu Le Mans in Steve McQueen schlummerten.
Dann kam das Jahr 1961. Ich hebe es deswegen etwas heraus, weil schon hier eine erste Weiche in Richtung eines Rennfilmes gestellt wurde. 1961 drehte McQueen in London nämlich den Film Wir sind alle verdammt (1962) von Philip Leacock und die Produzenten hatten angeordnet, dass er während der Arbeiten zu diesem Film an keinen Autorennen teilzunehmen hätte. In einer Drehpause widersetzte McQueen sich dieser Anordnung und nahm mit einem Mini Cooper an einem Rennen in Brands Hatch teil. Er wurde Gesamtdritter.
Während der laufenden Dreharbeiten zu einem Film an einem in der Region stattfindenden Rennen teilzunehmen, war eine Praxis, an der McQueen nahezu bis zum Ende seiner schauspielerischen Karriere festhalten würde. Noch viel wichtiger war aber, dass er bei diesen Dreharbeiten Robert Daleys Sachbuch The Cruel Sport: Grand Prix Racing 1959-1967 für sich entdeckte und seine Produktionsfirma Solar Productions beauftragte, die Buchrechte mit der Absicht zu erwerben, zusammen mit John Sturges einen Rennsportfilm daraus zu entwickeln. Der Arbeitstitel stand schnell fest: Day of the Champion.
Zunächst war McQueen aber noch vertraglich verpflichtet und drehte erstmal den Film Gesprengte Ketten (1963/ John Sturges). Und schon wieder präsentierte McQueen seinem erneut am Nervenzusammenbruch dahintaumelnden Regisseur eine Idee: Wie wäre es, wenn seine Rolle des Capt. Virgil Hilts mit einem Motorrad über den Lagerzaun springen würde, um zu entkommen? Sturges war nicht abgeneigt, verbot McQueen aber, dass er den Sprung selbst ausführt. Da diese Sequenz natürlich nicht im Drehbuch zu finden war und kein Motorrad dementsprechend vorbereitet war, wurde für den Sprung jene Triumph TR6 Trophy in den Farben der Wehrmacht auserkoren, die McQueen als persönliches Fortbewegungsmittel am Filmset im Perlacher Forst zur Verfügung gestanden hatte. Über Nacht bekam das Motorrad von den Mechanikern stabilere Federn und Dämpfer eingesetzt, vielleicht auch diverse Verstärkungen am Rahmen. Der Sprung selbst wurde schließlich vom Triumph-Händler und Stuntman Bud Ekins durchgeführt. Da McQueen aber einer von zwei echten Motorrad-Cracks am Set war, ließ er es sich nicht nehmen, eine Wehrmachts-Uniform anzuziehen und auf einem anderen Motorrad „sich selbst“ zu jagen, dem Filmschnitt sei Dank. Das kostete Sturges bestimmt ein paar graue Haare aber kein Regisseur hätte freiwillig auf dieses Potential verzichtet.

Nach den Dreharbeiten wurde das Motorrad an einen örtlichen Landwirt verkauft, der es zum Hüten seines Viehs einsetzte. Laut Informationslage stand es danach offenbar jahrzehntelang in einer Scheune, bis es der Triumph-Sammler Dick Shepherd entdeckte, kaufte und anfing, das Motorrad mit 95% der Originalteile sorgfältig in jenen Zustand zu restaurieren, in welchem es bei den Dreharbeiten im Jahre 1962 eingesetzt wurde. Und bis heute verleiht er es an verschiedene Museen.
Danach stand McQueen noch für einige weitere Filme vor der Kamera, u.a. für Cincinnati Kid (1965) von Norman Jewison. Es war kurz nach Beendigung der Dreharbeiten zu diesem Film, als sein Herzensprojekt mit dem Arbeitstitel Day of the Champion endlich Gestalt annehmen konnte.
Drehbeginn war schließlich am 1. August 1965. Ein Lola T70 Spyder (Fahrgestellnummer #SL70/05) wurde hierfür an Front und Heck extra mit Montageplatten für Arriflex– und Panavision-Kameras ausgestattet und vom Rennfahrer Sir John Whitmore auf dem Kurs der Tourist Trophy in Oulton Park gefahren, um eine echte Rennatmo einzufangen. Auf der Nordschleife des Nürburgrings wurde der Lola-Kamerawagen dann für ein paar schnelle Runden von seinem berühmten Besitzer übernommen, dem vierfachen Formel 1-Vizeweltmeister Stirling Moss. Dennoch muss man auch einen Toast auf jene Kameramänner aussprechen, die auf dem heißen Stuhl Platz nahmen.
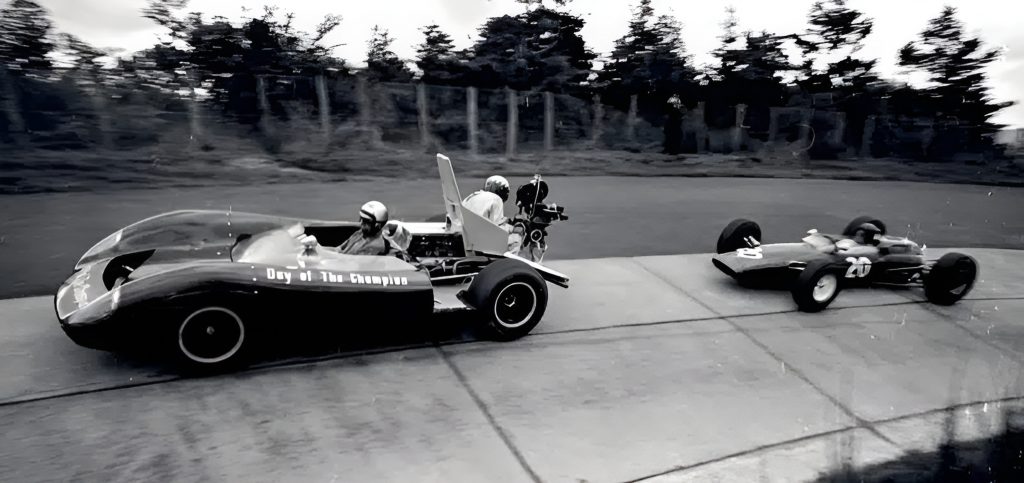
In die Dreharbeiten platzte jedoch die Nachricht, dass John Frankenheimer ebenfalls an einem Rennfilm arbeiteten würde und angeblich basierte das Projekt auch auf dem Buch The Cruel Sport. Ich habe keine Ahnung, ob Frankenheimer ebenfalls die kompletten Filmrechte an The Cruel Sport besaß, es ist alles sehr verworren, aber er besaß definitiv die Bildrechte für alle(!) Filmaufnahmen, die am Nürburgring gedreht wurden, inklusive derer, die John Sturges für McQueens Filmprojekt Day of the Champion hatte drehen lassen. John Frankenheimer hatte hierfür extra einen Vertrag mit den Behörden des Landes Rheinland-Pfalz geschlossen. Da weitere Verhandlungen über eine Zusammenarbeit zwischen Frankenheimer und Sturges scheiterten und ein Formel 1-Rennfilm ohne Aufnahmen vom Nürburgring keinen Sinn machen würden, stellte Sturges die Arbeiten an Day of the Champion ein. Und schon wieder war an McQueens Projekt eines Rennfilmes die Pausetaste gedrückt worden.
John Frankenheimer brachte seinen Rennfilm dann im Jahre 1966 auf die Leinwand: Grand Prix! Weil Grand Prix aber in der Formel 1-Welt spielte, fokussierte McQueen sich nun kurzerhand auf das wichtigste Automobilrennen der Welt: Die 24 Stunden von Le Mans!
Das passte sowieso viel besser, denn Langstreckenrennen lagen McQueen und er hatte ja ohnehin beschlossen, nur noch seinen Leidenschaften nachzugehen.
Wie bereits weiter oben beschrieben, war Grand Prix formal richtig gut gefilmt und bot dazu auch noch liebenswürdige, schöne und kluge Menschen in einer schönen Umgebung auf, hatte aber dennoch unnötig romantische Handlungsdetails, die McQueen nicht überzeugen konnten. Und er hatte ja Recht: Liebestrunkene Rennfahrer sind unprofessionelle Gefährder und daher unrealistisch.
John Frankenheimer mochte seinen Film zwar schneller abgeliefert haben, trat aber leider auch den Beweis an, dass der frühe Vogel eben auch nur den frühen Wurm fängt!
Bis Steve McQueen aber an seinem Ziel ankommen würde, drehte er erstmal unverdrossen weiter, zum Beispiel die Filme Thomas Crown ist nicht zu fassen (1968/ Norman Jewison) und Bullit (1968). Zum Glück musste er bei letztgenanntem Film seinen progressiven Regisseur Peter Yates nicht sehr lange von der Idee einer essentiellen Verfolgungsjagd überzeugen: Circa sieben Minuten lang, untermalt und eingerahmt von Lalo Schifrins kongenialem Score, sollte sie Filmlegende werden. Fest steht auch: Selten zuvor wurde „Coolness“ so gut eingefangen.

Dass hierbei ein Kultfilm entstehen würde, galt jedoch keineswegs als ausgemacht, der fertige Film war nämlich alles andere als perfekt. So verloren die Chasing-cars, ein Ford Mustang GT390 und ein Dodge Charger R/T während der Verfolgungsjagd mehr Radkappen, als diese Fahrzeuge Räder hatten. Und der legendäre, in fast jeder Stadtszene der Verfolgungsjagd auftauchende, dunkel-grüne VW Käfer, deutete ebenfalls darauf hin, dass dem Editor nicht genügend brauchbares Filmmaterial zum Schneiden dieser Sequenz zur Verfügung gestanden hatte. Außerdem verschwanden in meinem Kopf längst jegliche weitere Handlungsstränge dieses Filmes im Rauch durchdrehender Räder. Aber das kalifornische Black-plate „JJZ 109“ des Mustangs brannte sich für immer in mein Gehirn ein.
Als der Ex Talkshow-Host und Petrolhead Jay Leno viele Jahre später herausgefunden haben wollte, dass man auf der Motorentonspur von Lieutenant Frank Bullits Ford Mustang GT390 keinen 390cbi (6,4 Liter) V8 Motor, sondern das Motorengeräusch und die Schaltvorgänge eines 289cbi (4,7 Liter) V8 Motor aus einem Ford GT40 hören soll, war die Legende schon längst zementiert. Ich nehme mal an, dass Leno für diesen Test ausgiebige Rundfahrten mit baugleichen Fahrzeugen aus seiner Sammlung unternommen haben wird und dabei sehr viel Spaß hatte.
Derweil ging McQueen weiterhin seiner wahren Leidenschaft nach und sammelte bei lokalen Rennen weiterhin Achtungserfolge. Jedenfalls bis zu jenem Zeitpunkt, in welchem er mit einem deutlichen Ausrufezeichen in die motorsportlichen Geschichtsbücher einging:
Zusammen mit Peter Revson, einem Revlon-Erben und fahrerischen Supertalent, erzielte er bei dem Weltmeisterschaftslauf zur Langstrecken-WM um die 12 Stunden von Sebring am 21. März des Jahres 1970 den zweiten Platz im Gesamtklassement. Hierfür hatte McQueens Firma Solar Productions einen vom Porsche-Werk geleasten Porsche 908/01 Spyder mit der Startnummer „48“ eingesetzt. Von diesem Wagen werden wir später noch etwas mehr hören. Der motorsportbegeisterte Schauspieler hatte seine Metamorphose jedenfalls abgeschlossen und sich spätestens jetzt in einen schauspielernden Rennfahrer verwandelt.

In Sebring war das private Porsche-Team Revson/McQueen nur vom Ferrari-Werksteam mit den Fahrern Giunti/ Vaccarella und Andretti geschlagen worden. Trotz dieses Gewinns ließ es sich der zukünftigen Formel 1-Weltmeister des Jahres 1978 Mario Andretti aber nicht nehmen, sich etwas unsportlich zu äußern. Er merkte an, dass es ja nicht McQueen, sondern Revson war, der die meiste Zeit des Rennens in Sebring gefahren war und dass „die Schauspieler das Rennen fahren in Zukunft doch besser den großen Jungs überlassen sollten!“. Diese verbale Spitze zielte wahrscheinlich auch auf die Rennambitionen von James Garner und Paul Newman ab, aber McQueen fühlte sich dadurch nur noch mehr angespornt. Er plante, zusammen mit Jackie Stewart (Formel 1-Weltmeister 1969, 1971 und 1973), am 16. Juni 1970 auf einem Gulf-Porsche 917 bei den 24 Stunden von Le Mans zu starten.
McQueen war also mit der Sebring–Silberware im Gepäck nach Le Mans gereist und hoffte, endlich die ersehnte Anerkennung durch die von ihm so verehrten Profirennfahrer zu erhalten. Er wollte den Beweis antreten, dass er, McQueen, einer von ihnen ist.
Es waren die Versicherungen, die ihm hier einen Strich durch die Rechnung machten und seinem Le Mans-Team die Teilnahme an dem echten Rennen verwehrten. Vielleicht war das ganz gut so, denn so konnte er sich voll auf die bereits auf Hochtouren laufenden Dreharbeiten seines neuen Rennfilmes konzentrieren, die ja bereits schon am 7. Juni 1970, begonnen hatten. Er war am Ziel jener Reise angekommen, die im Jahre 1961 ihren Anfang genommen hatte. McQueens Produktionsfirma Solar Productions und die co-produzierende Cinema Center Films/ CCF hatten hierfür ein großes Produktionsdorf auf den Campingplätzen von Houx errichtet, unweit des Streckenabschnittes Tertre Rouge.

Wie man unschwer erkennen kann, gibt es an dieser Stelle heute davon natürlich keine Spur mehr, aber damals war das „Solar Village“ wirklich ein kleines Dorf, inklusive Administration, Lohnbuchhaltung, Projektionsraum und einer voll eingerichteten Kantine, in welcher einer der weltweit ersten Mikrowellenöfen stand. Hier befanden sich auch jene Trailer, in welchen die unabhängig voneinander schreibenden Teams der Drehbuchautoren Harry Kleiner und Ken Purdy ihr Möglichstes versuchten, den von McQueen auf das absolut Notwendigste zusammengestauchten Plot in eine kommerziell vorzeigbare Geschichte zu verwandeln. Vergeblich, denn alle ihre Ideen wurden letztlich verworfen. Derweil stand John Sturges immer noch für das Projekt eines Rennfilmes zur Verfügung. Vielleicht hatte er eine erste Ahnung, dass es nicht einfach werden würde, mit dem inzwischen nahezu unkontrollierbaren Steve McQueen einen annähernd dokumentarischen Film zu drehen, aber Sturges hatte seinen Film Verschollen im Weltraum (1969) vor Jahresfrist ja sogar komplett ohne Musikeinsatz gedreht und so ebenfalls eine zumindest semi-dokumentarische Atmosphäre erzeugt. Wer, wenn nicht Sturges, sollte die Ambitionen McQueens also besser verstehen können?
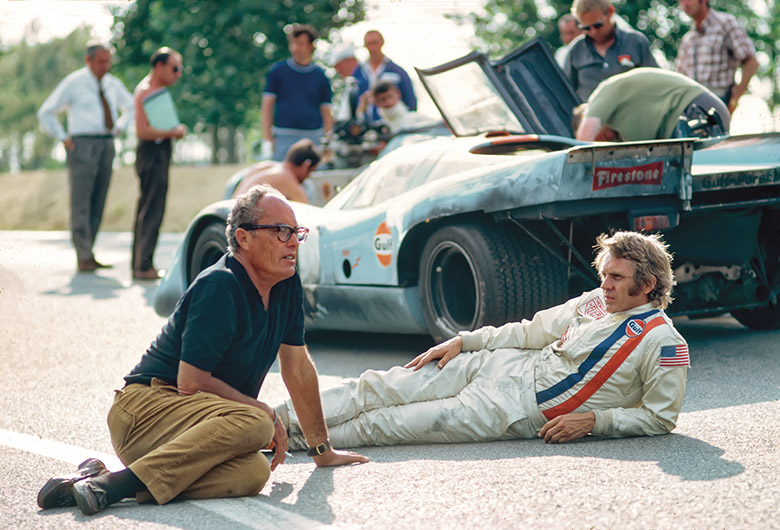
Die Produzenten Stu Nisbet, Jack N. Reddish und Robert L. Rosen machten allerdings so richtig Druck und versuchten, Einfluss zu nehmen, denn wie zuvor schon John Frankenheimer, wollten auch sie eine im Rennsportmillieu spielende Romanze, etwas, was James Goldstone 1969 bereits mit Winning aka Indianapolis gelang, und auch Sydney Pollack 1977 nochmal mit seinem Film Bobby Deerfield realisieren würde (siehe oben). Noch dazu sprach sich längst auch John Sturges dafür aus, das Kommerzielle nicht aus den Augen zu verlieren. „Wie kriegen wir den Film bloß weg von der Rennstrecke?“, soll er gesagt haben. Er dachte also an Liebesszenen, Beziehungskonflikte und an romantische Ausflüge der Hauptfiguren abseits der Rennstrecke. Zu diesem recht frühen Zeitpunkt der Storyentwicklung waren sich Sturges und McQueen also schon uneins darüber, was der Kern eines Rennfilms zu sein hat. In unzähligen Auseinandersetzungen forcierte John Sturges die aus der kommerziellen Perspektive notwendigen Nebenhandlungsstränge und versuchte, „seinem“ Hauptdarsteller Steve McQueen Entscheidungen im Sinne dieses Drehbuchs abzuringen.
Bis zu jenem Zeitpunkt, als McQueen in einer dieser Auseindersetzungen sinngemäß sagte: „Drehbuch? Welches Drehbuch? Die Story ist komplett in meinem Kopf. Und sie spricht für sich selbst!“.
Es ist nicht überliefert, ob es exakt diese Aussage war, die Sturges nach nur sieben Wochen dazu bewog, seine Koffer zu packen und dem Set den Rücken zu kehren. Fest steht nur, das er die Produktion wegen der üblichen „künstlerischer Differenzen“ verließ. Dennoch muss man John Sturges hier fast ein wenig in Schutz nehmen. Nach so vielen goldenen Jahrzehnten klassischer, und für den Film adaptierter und perfektionierter, 3-Akt Dramaturgien, die ihren Ursprung ja noch auf den Theaterbühnen der Alten Welt hatten, war es für die meisten Hollywood-Granden einfach undenkbar, eine Filmgeschichte auf die Dramaturgie eines Drehortes herunterzubrechen, ihn auf die reine Essenz zu reduzieren und alle menschlichen Darsteller zu Statisten zu degradieren. Im Jahre 1910 geboren, war Sturges ein „Thinking out of the box“-Mindset nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Obwohl er im Zweiten Weltkrieg als Mitglied des US Army Signal Corps für die Herstellung von Dokumentar- und Lehrfilmen verantwortlich war, wollte oder konnte er die Chance nicht erkennen, einen Film, im wahrsten Sinne des Wortes, für sich selbst sprechen zu lassen. Vielleicht wollte es sich Sturges auch nur nicht mit den Produzenten verscherzen.
Steve McQueen wollte hingegen nicht nur irgendeinen Rennfilm drehen, sondern nichts weniger als „den besten Rennfilm aller Zeiten“. Dafür musste man über alle Grenzen hinausgehen. Und über Leitplanken.

Aber nicht nur das: Alle Beteiligten mussten lernen, über den filmischen Tellerrand zu schauen und an jenen Regeln zu rütteln, welche seit Dekaden ihre Gültigkeit hatten. John Sturges hatte zwar versucht, dem innovativen McQueen ein paar Sperenzchen wieder auszutreiben und ihn in das uralte Hollywood-Unterhaltungsschema zurückzupressen, aber die Zeiten hatten sich geändert. Der Realitätsanspruch des „New Hollywood“ hatte sich ja längst etabliert.
Außerdem wusste McQueen inzwischen einfach viel zu genau, was er wollte. Nämlich die Grenzen der Wahrnehmung des Zuschauers so zu verändern, dass dieser in den Film hineingezogen würde. Er wollte den Film als 24-Stunden-Abriss im Leben eines Rennfahrers gestalten. Die Zuschauer sollten spüren, was es bedeutet, ein Rennfahrer zu sein… und damit endlich auch das, was er, McQueen, spürt.
Um dieses Ziel zu erreichen war der britische Kameramann Walter Lassally engagiert worden, der einen Oscar für den Film Alexis Sorbas (1964) gewonnen hatte. Aber was wissen wir nochmal darüber, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein? So ist es.
Um ihre Profite besorgt, und ohne Rücksprache mit der Crew, hatten die Produzenten nämlich kurzfristig angekündigt, dass aus dem bisherigen 10 Stunden pro Tag-Zeitplan nun 12 Stunden pro Tag-Zeitpläne werden würden. Von diesem Ansinnen der Produzenten wurde auch Walter Lassaly überrascht. Also nahm er ein Blatt Papier, schrieb „UNACCEPTABLE“ darauf und hängte es an das Production-Board. Am nächsten Tag war die Produktion nicht nur ohne Regisseur, sondern auch ohne Kameramann. Die Produzenten hatten den Oscar-Preisträger Lassaly entlassen. Damit aber noch nicht genug. Indess war die Cinema Center Films/ CCF offenbar auf den Geschmack gekommen. In einer Art „Nacht der langen Messer“ wurde ernsthaft überlegt, nun auch noch den Hauptdarsteller Steve McQueen zu ersetzen, natürlich erneut wegen „kreativer Differenzen“ und so traten sie mit dem Co-Produzenten Steve McQueen in Verhandlungen, der schließlich zustimmte, auf seine Gage zu verzichten und die kreative Kontrolle über den Film abzugeben. CCF würde hingegen aufgrund ihres erheblichen Investitionsanteils nicht nur die Filmfreigabe behalten, sondern würde im Gegenzug auch versuchen, so nah wie möglich an McQueens Vision herankommen, ohne sich jedoch die kommerziellen Chancen komplett zu verbauen. Diese Sorte Verhandlungen waren der absolute Tiefpunkt der Dreharbeiten. Um sich zu sammeln, folgten zunächst zwei Wochen Drehpause, in denen alle erstmal auf Abstand zueinander gingen. Steve McQueen und Siegfried Rauch fuhren nach Paris und die Techniker warteten die Rennwagen. Derweil suchten die Produzenten einen neuen Regisseur und neue Kameraleute. Zu diesem Zeitpunkt stieß auch der Drehbuchautor John T. Kelley zum Schreiberteam, um das Skript neu zu schreiben. Ob, und wie viele seiner schreiberischen Bemühungen den Weg in den fertigen Film fanden, konnte man vor gar nicht so langer Zeit bei einem Auktionshaus für ein Mindestgebot von £ 3.000,- herausfinden.
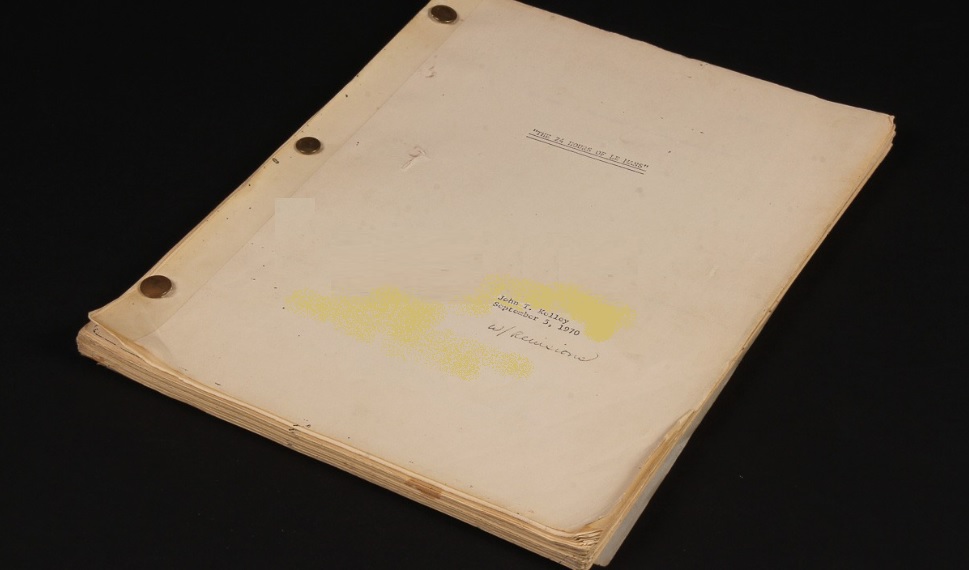
Als neuer Regisseur wurde schließlich Lee H. Katzin verpflichtet, als Ersatz für Walter Lassaly wurde u.a. René Guissart jr. engagiert, der später auch in seiner eigenen Formel 1-Dokumentation Overdrive (1973) beweisen würde, dass er imstande ist, die Seele des Motorsports einzufangen.
Ihm zur Seite gestellt wurde Robert B. Hauser, der die Kamera bei den beiden Filmen Ein seltsames Paar (1968/ Gene Saks) und Das Wiegenlied vom Totschlag (1970/ Ralph Nelson) führte. Außerdem wurde der Kameramann Alex Barbey engagiert, der zu diesem Zeitpunkt vor allem für seine Action-Skiaufnahmen des Filmes James Bond 007 – Im Geheimdienst ihrer Majestät (1969/ Peter R. Hunt) bekannt war und als absolut angstfrei galt. Die Produzenten hatten sich also bemüht.
Nach dem Ende der kreativen (Zwangs-) Pause geriet aber auch Regie-Nachfolger Lee H. Katzin in„künstlerische Differenzen“ mit dem Hauptdarsteller. Dass Katzin mit nahezu jedem ersten Take zufrieden war, sorgte bei McQueen für fassungsloses Entsetzen. Das von den Produzenten forcierte schnellstmögliche Herunterkurbeln der Skriptseiten konnte für einen Hauptdarsteller, der ja auf der Suche nach absoluter Authentizität war, nur ein Beleg für Gleichgültigkeit oder sogar Denkfaulheit sein. So übersah zunächst auch Katzin, dass es McQueen um die hohe Professionalität und die Genauigkeit in den Abläufen des Rennbetriebes ging. Letztlich verstand er dann aber ungefähr, was McQueen ausdrücken wollte und versuchte, ebenfalls in diese Richtung arbeiten. Katzin wurde daher so etwas wie eine Art „Assistant in Charge“ für McQueen, der ohnehin bereits schon wieder dazu neigte, die notwendigen Arbeiten komplett selbst zu erledigen…Vertrag hin, Vertrag her. Er war ja ohnehin bereits Rennfahrer, Autor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion.

Man kann niemandem in den Kopf schauen aber in der Nachbetrachtung erscheint es, als ob Steve McQueen auf der Suche nach der Darstellbarkeit der Seele eines Rennens war! Hierbei konnten die menschlichen Darsteller fast zwangsläufig nur Statisten sein und bei der Suche nach diesem Gefühl verlor er sich dann auch gerne mal etwas in den Details. Ich weiß natürlich, dass den meisten LeserInnen hierfür die Geduld fehlen könnte, aber ich finde Perfektion im Detail extrem anziehend, es ist einfach ein sichtbares Zeichen für Präzision und Sorgfalt.
Unter vielen ähnlich gelagerten Anekdoten von den Dreharbeiten stehen die beiden folgenden Beispiele geradezu exemplarisch für McQueens Denkansatz. So beauftragte er seine Assistenten, die Windschutzscheibe eines Porsche 917 mit toten Insekten zu bekleben, und zwar so, wie es aussieht, wenn ein Rennwagen im Sommer mit Höchstgeschwindigkeit fährt.
Wie man sich gut vorstellen kann, waren in den Inventarlisten der Requisite keine toten Insekten gelistet und so fingen die Assistenten in kleinteiligster Handarbeit an, die benötigten Insekten höchstselbst zu suchen und zu erschlagen. Als sie fertig waren, kam McQueen vorbei und glich die Insektenkadaver mit jenen bereits am Porsche 917 befindlichen toten Insekten ab, die ihr Ende bereits während einiger schneller Runden an der Windschutzscheibe gefunden hatten. Nur um dann festzustellen: „Wrong bugs, do it again!“.
Und Siegfried Rauch überlieferte in einem Interview die kleine Story, dass sie während eines Boxenstopps den Helm abnehmen und verschwitzt aussehen sollten. Gerade, als der Maskenbildner ihnen Wasser (oder war es sogar schon Glycerin?) ins Gesicht spritzen wollte, sprang McQueen auf, und sagte, dass es so nicht gehen würde. Also stieg er in einen Rennwagen und fuhr mal eben zwei schnelle Runden. Als er danach den Helm ablegte, sagte er, dass er jetzt bereit sei weil er nun richtig schwitze. Außerdem, so sagte er schmunzelnd, hätten die MaskenbildnerInnen die nun heftig pulsierende Ader an seiner Stirn niemals so gut hinbekommen. Aber dennoch wäre es nicht ganz richtig, wenn man nur McQueens ausgeprägten Hang zur Authentizität für die Verzögerungen bei den Dreharbeiten verantwortlich machen würde.
Natürlich waren es auch die unterschiedlichen Vorstellungen zum Thema Effizienz, die ihren Teil zum Chaos beitrugen. Als es bei einem der Porsche 917 beispielsweise technische Probleme gab, gaben die für die Vorbereitung zuständigen US-amerikanischen Porsche-Mechaniker an, dass der Schaden recht komplex wäre und sie zur Behebung des Problems rund zwei Tage benötigen würden.

Das erschien McQueen zu lang. Also fragte er zwei zufällig an der Strecke befindliche Porsche-Werksmechaniker nach ihrer Expertise. Nachdem sie sich das Problem angeschaut hatten, trafen auch sie die Einschätzung, dass die Behebung des Problems in der Tat sehr komplex wäre und die Instandsetzung daher länger dauern würde; mit zwei Stunden müsste man schon rechnen.
Die amerikanischen Porsche-Mechaniker fanden das natürlich nicht ganz so lustig aber diese kleine Anekdote bildet sehr schön die unterschiedlichen Mentalitäten ab, welche am Filmset herrschten. All diese unterschiedlichen Interessen, Ambitionen, oder Motive bremsten die Dreharbeiten also mehr als nur einmal aus. Zusätzlich wollten ja bis zu zwanzig Kameras gleichzeitig koordiniert werden. Wohlgemerkt an der Strecke und an den Fahrzeugen. Man experimentierte zwischenzeitlich sogar mit bis zu fünf(!) Kameras gleichzeitig an einem Porsche 917. Zum Glück erkannte man schnell, dass dieses Fahrzeug von irgendeiner „Fahrbahrkeit“ weit entfernt war und alle Beteiligten in ernsthafte Gefahr bringen könnte. Also wurde dieser Wagen wieder zurückgebaut, was erneut einen ganzen Tag verschlang.
Tja, und nun wird es Zeit für’s Eingemachte. Unverständlicherweise muss an dieser Stelle auch über fünfzig Jahre nach dem Erscheinen dieses Filmes erneut darauf hingewiesen werden, dass nun eine akute partielle Spoilergefahr zum Inhalt des Filmes entstehen wird, wobei jeder, der schon mal Vorberichte zu einem Rennen, oder ein Rennen selbst gesehen, oder auch nur etwas darüber gelesen hat, kaum überrascht sein dürfte. Der folgende Einblick in die Handlung ist aber nötig, um die Verquickung des Filmes mit der Realität einzufangen. Worum geht es also?

Unter der sachlichen Kameraführung von Rene Guissart und zur luftigen Musik Michel Legrands fährt ein schiefergrauer 1970er Porsche 911 (Fahrgestellnummer #91103 01502/ im Jahre 2011 für $ 1.375.000,- verkauft) offenbar in den frühen Morgenstunden durch die menschenleere nordfranzösische Provinz, vorbei an Feldern, durch Alleen und über Brücken. Nachdem er das Ortszentrum des beschaulichen Örtchens Le Mans hinter sich gelassen hat, erreicht er den zu diesem Zeitpunkt noch öffentlichen Straßenteil bei Maison Blanche und hält direkt bei einem sichtbar neu eingesetzten Leitplanken-Abschnitt an (exakt dieses neue eingesetzte Stück Leitplanke erzählt eine ganz eigene Geschichte; dazu später mehr). Der Fahrer steigt aus, die Musik ist längst dem leisen Geräusch des Windes gewichen… irgendwo in der Ferne bellt ein Hund. Er hält inne… aus der Tiefe der Erinnerungen drängen Bilder und Geräusche in sein Bewusstsein… the Dead walk!

Der Fahrer, der sich seinen Dämonen stellt, ist Michael Delaney. Er überlebte im letzten Jahr denselben Unfall, in welchem sein Renngegner, Ferrari-Werksfahrer Piero Belgetti zu Tode kam. Dieses Jahr wird sein Gegner der Ferrari-Werksfahrer Erich Stahler (Siegfried Rauch) sein. Delaney ahnt, dass er auch Pieros Witwe Lisa (Elga Andersen) nicht länger aus dem Weg gehen wird können und ihr in den Boxen, im Fahrerlager oder beim Catering begegnen könnte. Er steigt wieder in seinen Wagen und fährt in Richtung Le Mans Fahrerlager.
Nach einem geschüttelt Maß an dokumentarischen Filmaufnahmen der Atmosphäre an und um die Strecke herum, sitzt Michael Delaney irgendwann in seinem Gulf-Porsche 917… Konzentration, das Gehirn filtert die Außen-Geräusche raus… Ruhe, absolute Ruhe… eine Minute bis zum Start… ein sich ganz langsam beschleunigender Herzschlag… Zündung an… der immer wilder werdende Herzschlag scheint die Adern bersten zu lassen. Puls 200, halt das Übliche. Der Zeiger der Streckenuhr erreicht 16 Uhr! Die Startflagge fällt!
Die Motoren brüllen explosionsartig auf, längst ins Blut eingegangene Bewegungsabläufe werden vollzogen, Gas, Kuppeln, Schalten, Gas, Kuppeln, Schalten, Gas, Kuppeln, Schalten, Gas Gas Gas.. unter dem weltberühmten Dunlop-Bogen hindurch… einen Gang runter… durch die Esses in Richtung Tertre Rouge und auf den Mulsanne-Straight, besser bekannt als Hunaudières-Gerade. In diesem Jahr ist sie noch, ohne jegliche Schikanen zu befahren, aber auch später ist sie eine jener beiden Passagen mit der höchsten Mortalitätsrate. Daran denkt man aber nicht und schaltet alle Gänge durch… „Pedal to the Metal“.

Im Jahre 1970 bedeutete dies: Mit Vollgas über die Hunaudières-Gerade und durch die schnellste Kurve des Kurses, ein leichter Rechtsknick, den sogenannten „Mulsanne-Kink“, bis man 300-250 Meter vor der nahezu rechtwinkligen Mulsanne-Kurve den Wagen von angenäherten 380km/h auf
ungefähr 80km/h zusammenstauchte, um durch die nahezu rechtwinklige Kurve zu schwänzeln. Anschließend erneut durch alle Gänge hochbeschleunigen. Nach der Golf-Kurve, einem weiteren kleinen Rechtsknick im Wald, sind erneut 330km/h erreicht. Dann mit aller Gewalt auf einer perfekten Linie in die leichte Rechtskurve vor dem absoluten Lefthander der Indianapolis-Kurve hineinbremsen, um von dort einen circa drei Sekunden dauernden 180km/h-Spurt bis zur langsamsten Stelle des Kurses hinzulegen, bevor man die rechtwinklig nach rechts abknickender Arnage-Kurve mit nur 60km/h durchfährt. Dann erneut Vollgas geben, in Richtung Maison Blanche/ Whitehouse Corner.
Maison Blanche! Bis weit hinein in die 1970er Jahre war diese Stelle ein extrem trickreicher Streckenabschnitt innerhalb eines kleinen Linksknicks, der etwas schmaler war als der gesamte Rest der Strecke. Und es ist jener Ort, wo bereits im Jahre 1927 alle drei(!) Werks-Bentleys verunfallten, oder wo 1937 nicht nur der Bugatti T44-Fahrer Rene Kippeurth und der Frazer Nash-BMW 328-Fahrer Pat Fairfield, sondern 1953 auch Tom Cole im Ferrari 340MM und 1956 Louis Héry im Monopole X86-Panhard tödlich verunglückten. Aber das war noch nicht genug. Seit 1923 starben an der Gesamtstrecke 118 Menschen, 21 davon Rennfahrer. Auf keiner anderen Strecke war der Blutzoll ähnlich hoch.

Der Film Le Mans bot und bietet einen authentischen und ungeschönten Blick auf das, was die Fahrercharaktere der ausgehenden 1960er oder der beginnenden 1970er Jahre umgetrieben hat. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie nahezu in jedem Rennen einen ihrer Freunde verloren haben und sie, vielleicht ebenfalls auf der Suche nach Wahrhaftigkeit, dennoch immer weiterfuhren. Nach all den Jahren ist Le Mans also nicht nur ein Abbild seiner Ära, sondern dient inzwischen auch als Psychogramm getriebener Rennfahrerseelen, heruntergedampft auf diesen einen, längst schon zu Tode gerittenen, legendären Satz Steve McQueens:
„Racing is Life! Anything that happens before or after is just waiting!“. Der Film bebilderte diese Rennfahrer-Weisheit.
Im Bereich Maison Blanche geriet der Privatfahrer John Woolfe in seinem Porsche 917 Langheck Coupe (Fahrgestellnummer #917-005) im Jahre 1969, also ein gutes Jahr vor den Dreharbeiten, mit zwei Rädern neben die Strecke. Er verlor sofort die Kontrolle und schlug unmittelbar in die Leitplanken ein, wo es den Wagen einfach zerriss. Woolfe wurde aus dem Wagen geschleudert und war auf der Stelle tot. Im nachfolgenden Ferrari 312P (Fahrgestellnummer #0872) konnte der Neuseeländer Chris Amon, der Sieger von 1966, nicht mehr ausweichen und fuhr auf den herausgerissenen brennenden Tank des Porsche. Der auf diese Weise aufsitzende Ferrari ging sofort in Flammen auf. Amon hatte Glück und entkam dem Inferno mit nur leichten Verbrennungen.
Exakt an diesem Ort, erkennbar an dem neu eingesetzten Leitplanken-Abschnitt, hielt Michael Delaney in der Eröffnungssequenz mit seinem Porsche 911 an. Der Film machte es dem Zuschauer ohnehin schon schwer zu erkennen, wo er sich im Bereich der Realität, und wo er sich im Bereich der Fiktion bewegte, aber in dieser Sequenz warf die Realität ihren Schatten über die Fiktion und die Fiktion spiegelte diesen Schatten in die Realität zurück.

Im Bemühen um einen respektvollen Umgang honorierte diese Kameraeinstellung das neue Stück Leitplanke, welches nach dem Feuerunfall John Woolfes im Jahr 1969 exakt an dieser Stelle eingesetzt wurde. Wie prophetisch die Einstellung aber wirklich sein würde, konnte da ja noch niemand ahnen, denn während der Le Mans–Dreharbeiten würde an dieser Stelle auch der Rennfahrer David Piper eine Begegnung mit dem Schicksal haben. Dazu aber später mehr. Fakt war: Dieser Ort forderte seit Dekaden Menschenopfer und Steve McQueen war klug genug, ihn für diese Szene zu nutzen. Es war schlicht der beste Platz dafür. Während des echten Rennens des Jahres 1970 verunfallten hier vier(!) Ferrari 512S in nur einem(!) Unfall und noch 1972 starb hier, wie zur Bestätigung, der allseits beliebte Rennfahrer Joakim Bonnier, als er mit seinem Lola T280-Cosworth versuchte, einen langsameren Konkurrenten zu überholen Das folgende Bild mit dem Strecken-Layout des Jahres 1970 zeigt die Problematik. Von Arnage kommend, kam man in Maison Blanche mit Höchstgeschwindigkeit an, war also schon wieder im „High-Speed-Tunnel“ und wer darüber vergessen hatte, dass die Kurve nicht nur „zumacht“, man hier also das Gaspedal lupfen musste, oder dass dieser Abschnitt keinen Platz für zwei oder mehr nebeneinander herfahrende Wagen bot, flog unweigerlich ab.
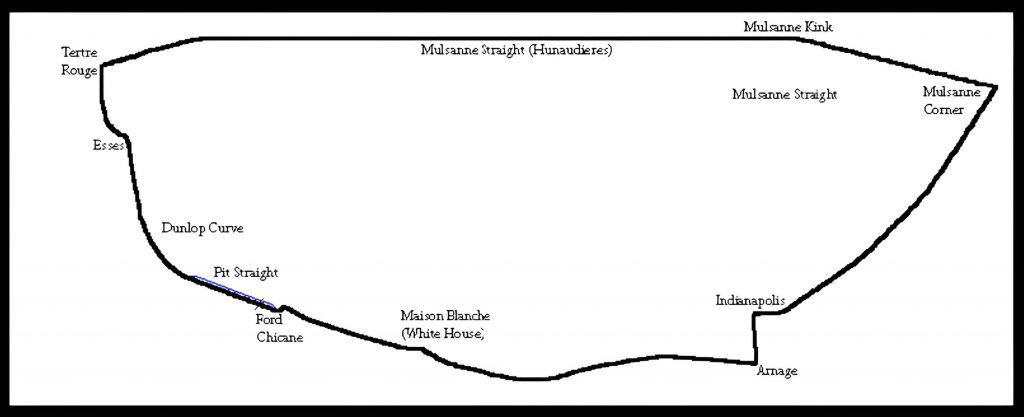
Hatte man Maison Blanche aber überlebt, schoss man 1970 mit circa 320km/h auf die alte Ford-Schikane vor der Start/Ziel-Geraden zu. Ebenfalls keine unproblematische Stelle, denn im Jahr 1970, ein paar Wochen vor den Dreharbeiten, verlor hier Jackie Ickx, Sieger von 1969 und jetzt an zweiter Stelle liegend, die Kontrolle über seinen Ferrari 512S und tötete einen Strecken-Marschall.
Heute eine wirksame Stelle, wo die Geschwindigkeit verlässlich abgebaut werden kann, war diese Schikane damals über alle Maßen entscheidend, denn wie man aus ihr herauskam, entschied über alle folgenden Passagen und welche Höchstgeschwindigkeiten man auf der Hunaudières-Geraden erreichen würde. Also volle Konzentration… schön flüssig durch die 1970 noch einfache Links-Rechts-Kombi… und Vollgas auf die Start/Ziel-Gerade an den Boxen vorbei, wo dann wieder alles von vorne beginnt.
Jetzt waren es nur noch 23 Stunden, 56 Minuten und 30 Sekunden bis zum Ziel! Und das in voller Konzentration! Und dennoch kann man das komplette Rennen auch in den letzten 20 Sekunden und auf den letzten 500 Metern verlieren, sogar dann, wenn man 23 Stunden und 59 Minuten und 40 Sekunden überlegen geführt hatte. Das Ziel ist also nicht so schnell wie möglich zu fahren, sondern konzentriert so langsam wie möglich schnell zu fahren, dem Leitsatz des britischen Special Air Service folgend: „Slow is smooth and smooth is fast!“.
Aus dem Amateur-Rennfahrer und Schauspieler McQueen war längst der Profi-Rennfahrer Michael Delaney geworden. Seine Gesten, seine Bewegungsabläufe und seine Blicke waren deshalb so glaubwürdig, weil er sie längst nicht mehr spielen musste.

Die Dreharbeiten endeten am 10. November 1970 und sämtliches gedrehte Filmmaterial ging in die Postproduktion. Ganz ohne Steve McQueen, denn er hatte seinen Einfluss in dieser Sparte bereits abgegeben. Die Schnittmeister Ghislaine Desjonquères, Donald W. Ernst und John Woodstock verwandelten die sachlichen, dennoch aber elegant eingefangenen Bilder der Kameramänner René Guissart, Robert B. Hauser und Alex Barbey in ein meisterhaftes und fiebriges Filmkunstwerk.
Bei der Kombination aus dokumentarischen Filmbildern des echten Qualifyings, Aufnahmen des echten Rennens und dem für den Film gedrehten Material, gab sich Le Mans keine einzige Blöße. Stellt euch nur mal vor, wie sehr der Hauptdarsteller und Co-Produzent auf Kohlen gesessen haben muss. So ganz ohne Möglichkeit, krerativ einzugreifen.
Aber die Sorge war unbegründet. Überliefert ist, dass Steve McQueen vom fertigen Film begeistert war und dass er tatsächlich seinen Anspruch an Authentizität erfüllt hatte. Alle Rennszenen wurden seinem Wunsch gemäß in den originalen Rennwagengeschwindigkeiten abgedreht. Einzig für die Unfallsequenzen wurde das Stilmittel der Zeitlupe verwendet. Und selbst dem Handlungsstrang um die hinzugefügte Rolle der Lisa Belgetti attestierte er eine Authentizität innerhalb des Rennbetriebes. Und das war alles, was er wollte. Das war das Ziel.

Am 23. Juni 1971 hatte der fertige Film seine Erstaufführung in Indianapolis, jenem Ort, an dem Steve McQueen aufgewachsen war. Am 7. Juli 1971 hatte Le Mans dann in San Francisco seine Premiere, am 15. Juli 1971 in London und am 24. September 1971 in Paris. In Deutschland wurde Le Mans schließlich am 28. Oktober 1971 uraufgeführt.
Vier Tage vorher, am 24. Oktober 1971, hatte sich jedoch eine Schlüsselfigur des Filmes für immer verabschiedet: Joseph „Jo“ Siffert. Er war bei einem Rennen in Brands Hatch tödlich verunglückt, an jenem Ort, an welchem Steve McQueen zehn Jahre vorher, im Jahre 1961, auf einem Mini Cooper Dritter wurde und wo er jenes Buch fand, mit welchem diese Reise begann. Von Siffert wird aber gleich noch die Rede sein, denn wir haben es zu einem großen Teil auch ihm zu verdanken, dass Le Mans heute noch diesen Stellenwert besitzt. Nebenbei bemerkt einen Stellenwert, den eine bekannte und einflussreiche Kritikerin der New York Times damals nicht kommen sah: „Two hours of noise, headaches and a ridiculous eleven spoken ‚lines‘ – I’m not doing that to myself!“.
Das liest sich, als hätte hier eine Kritikerin lieber von sich und ihren Bedürfnissen sprechen wollen als über den Film. Keine Ahnung, aber es waren wohl auch solch fachlich unqualifizierte Ergüsse, die dazu geführt hatten, dass das Publikumsinteresse gering war.
In der (selben?) Presse war sogar von einem veritablen „Flop“ an der Kinokasse die Rede. Um in der Kategorie eines „Flops“ mal einen Vergleich anzustellen: Le Mans wäre dann in der gleichen Schublade zu finden, wie Speed Racer (2008) von Lana und Lilly Wachowski. Und hier hatte sich noch nicht einmal jemand die Mühe gemacht, dem Rennfahrer ein Nomex-Balaklava überzuziehen.

Sicherlich konnte der Zuschauer den Fahrer so viel besser sehen. Andererseits würde der Fahrer bei einem Feuerunfall wohl seinen makellosen Teint verlieren. Angesichts solcher Zugeständnisse an die Zuschauer, erschließt sich hoffentlich aber auch motorsportunbefleckten Zuschauern, dass das Merkmal eines „Flops“ keine Substanz hat, um einen Film qualitativ einzuordnen.
Und wo wir schon mal bei den Fakten sind: Bei einem Produktions-Budget von 7,6 Millionen Dollar soll Le Mans am Startwochenende in den USA (Boxoffice) angeblich nur 5,5 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt haben. Auch das ist weder unser Problem, noch sollte es Gegenstand einer Filmkritik sein. Insbesondere, weil Regisseur Lee H. Katzin in einem Interview kürzlich ein Einspielergebnis von 22 Millionen Dollar zu Protokoll gab. Es ist wohl alles eine Frage der Perspektive und des zugrunde liegenden Zeitabschnitts. Ob es nun also am Startwochenende war, oder über einen längeren Zeitraum ging: 22 Millionen Dollar war dieselbe Summe, wie sie seinerzeit auch der großartige Dirty Harry (1971 / Don Siegel) einspielte. Und der konnte ebenfalls mit einem ultracoolen Hauptdarsteller aufwarten.

Der eigentliche Punkt ist: Ob ein Film nun die Erwartungen eines gelangweilten Kritikers nicht erfüllen konnte, oder zu Selbstzweifel einer kopfschmerzgeplagten Kritikerin geführt hat, oder ob er nun ein finanzieller Erfolg oder Misserfolg war, sagt nicht mal annähernd etwas über die Qualität eines Filmes aus. In keinem Genre! Ja, es stimmt Solar Productions musste Konkurs anmelden und auch Cinema Center Films/ CCF,verschwand 1972 nicht von der Bildfläche, ohne einen Verlust von 30 Millionen Dollar zu hinterlassen. Was blieb also? Steve McQueen verstarb am 7. November 1980, wahrscheinlich ohne zu ahnen, dass dieser Film dem Fachpublikum auch 50 Jahre später immer noch Anerkennung und Respekt abringen würde. Das diese Anerkennung kein künstlich herbeigeführter McQueen-Hype, sondern mit Fakten zu unterfüttern ist, d.h. wie gut Le Mans tatsächlich war und wie gut er wirklich das Gefühl dieser Ära transportieren konnte, zeigen u.a. auch Vergleiche mit lupenreinen Motorsport-Dokumentationen. Zu nennen wären hier der psychodelische Champions Forever – The Formula One Drivers (1975 / Claude Du Boc) mit beeindruckenden Nahaufnahmen und Speed Fever (1978) von Ottavio Fabbri und Mario Morra , der mit tollen Zeitlupen aufwarten konnte, während kaum eine Dokumentation den Zuschauer so nah an einen Fahrer heranbrachte, wie Roman Polanskis brillante Formel 1-Dokumentation Weekend of a Champion (1972/2013): Während des Großen Preises von Monaco 1971 schaute er dem Weltmeister Jackie Stewart über die Schulter. Und dann wäre da noch The Speed Merchants (1972). Michael Keysers in der Sportwagen-Weltmeisterschaft des Jahres 1972 angesiedelte Dokumentation gilt bis heute als Benchmark für Motorsport-Dokumentationen und bediente sich ähnlicher filmischer und dramaturgischer Mittel wie Le Mans: Die besten verfügbaren dokumentarischen Filmaufnahmen mit den besten Perspektiven der besten Rennwagen ihrer Ära, ein perfekter Filmschnitt und einen auf die Dramaturgie der Bilder abgestimmten Musikeinsatz, hier in Kombination mit einem Off-Sprecher und natürlich viel Nähe zur Materie. Resultat? Die transportierte Stimmung ist nahezu identisch! Der Zuschauer swingt geradezu mitten ins Zentrum dieser fiebrigen Ära.
Das folgende Bild aus The Speed Merchants illustriert diese Nähe zwischen dem Rennbetrieb (hier der Targa Florio) und der Zuschauerschaft ganz gut und ist weit entfernt von der aseptischen Beziehung, welche die beiden Interessensgruppen heute, möglicherweise aus gutem Grund, pflegen.

Im Gegensatz zu nahezu allen bisher genannten Spielfilmen im Automobil-Genre, leistete sich der Film Le Mans in seinen Kernkompetenzen absolut keine Schwächen, keine schneller abgespielten Szenen um künstlich Dynamik zu simulieren, keine unnötigen Handlungsstränge oder Ausflüge in sinnlose Nebenkriegsschauplätze, und noch viel wichtiger: Keine Holzhammer-Dramaturgien in Form zweier Menschen in einem Ruderboot auf einem Waldweiher im Gegenlicht.
Um den Wahnsinn dieser Ära und der rauschhaften Dreharbeiten zu diesem Film angemessen zu würdigen, kann es also nur einen Weg geben: Nämlich, sich genauso detailverliebt einen Überblick zu verschaffen, wie die Beteiligten es ihrerzeit auch getan hatten.
Da sich in dem Film Le Mans die Charaktere weitestgehend über Blicke und Gesten mitteilten und die Atmosphäre über die Bilder, den Ton und den Schnitt dieser beiden Gewerke vermittelt wurde, fällt die übliche Annäherung an die Schauspieler natürlich schwer. Der Film befindet sich also auch hier eindeutig in der Tradition des „New Hollywood“.

Zugegeben, die Verpflichtung von Siegfried Rauch war ein Geniestreich, seine Rolle des Ferrari-Werksrennfahrers Erich Stahler war der perfekte Counterpart und in Sachen Coolness durchaus auf Augenhöhe mit Steve McQueen. Dieser hatte „Ziggy“ in dem Film Patton- Rebell in Uniform (1970) gesehen und ausgerufen: „Den will ich als Gegenspieler!“. Um der Rolle eines Werksfahrers der Scuderia Ferrari gewachsen zu sein, hatte Siegfried Rauch sich extra einen Porsche 914 gekauft. Aufgrund seiner Mittelmotorbauweise ähnelte die Fahrdynamik dieses Fahrzeugtyps jener des Ferrari 512S, welchen Rauch im Film fahren sollte. Es war genau diese Arbeitshaltung, die McQueen schwer imponierte.
Schwieriger gestaltete sich da schon die Suche nach der Darstellerin von Lisa Belgetti, der Witwe des verunfallten Piero Belgetti, denn in der ursprünglichen Drehbuchfassung gab es diese Rolle noch gar nicht. Schnell wurde klar, dass McQueen sich Diana Rigg wünschte, aber diese hatte offenbar andere Verpflichtungen. Das Model Lesley Lawson aka Twiggy war kurz im Gespräch und Maud Adams wurde alleine aufgrund ihrer Größe verworfen. Eine Darstellerin, die dem Star des Filmes fast auf den Kopf spucken könnte, war kaum vertretbar. Egal, sie wurde schließlich als mehrfaches Bond-Girl berühmt. All diese Entscheidungen machten den Weg für die deutsche Schauspielerin und Sängerin Helga Anderson aka Elga Andersen frei.

Meiner bescheidenen Meinung nach war sie nichts weniger als die perfekte Wahl, ein absolut ikonisches Gesicht der 1970er Jahre. Sie verlieh ihrer nach Antworten suchenden Rolle die richtige Mischung aus Last und Selbstbewusstsein.
Allerdings war die von einem schmonzettensüchtigen US-Publikum der 1970er Jahre erwartete, und von einigen Kritikern im vorauseilendem Gehorsam hastig herbeigeschriebene „angedeutete Liebesgeschichte“, natürlich nur eine Chimäre. Die Beziehungskonstellation Lisa Belgettis und Michael Delaneys beleuchtete vielmehr die Bemühungen zweier, aufgrund einer Tragödie miteinander verbundenen Menschen auf ihrer Suche nach einem gesunden Umgang miteinander. Diese Beziehungsvariante tat der Erzählung des Filmes zwar ausgesprochen gut, war dem damaligen Publikum aber so nicht zu kommunizieren. Zu weit klaffte die Erwartungshaltung der Konsumenten und das gebotene Szenario auseinander.

Darüber hinaus wurde aber alles getan, um eine möglichst hohe Glaubwürdigkeit in der Sache zu erreichen. Die besten verfügbaren Rennfahrer und Rennteams ihrer Zeit waren verpflichtet worden, ohne deren Engagement (und auch Blutzoll!) die Realisierung dieses Filmes unmöglich gewesen wäre, als da wären das Gulf JWA/ John Wyer Automotive Engineering Ltd.-Team und das Porsche Salzburg Racing Team, dann natürlich die Scuderia Ferrari, Matra Sports und Lola Cars Ltd., sowie private Rennställe, wie die Belgische Ecurie Francorchamps, die Schweizer Scuderia Filipinetti und das Henri Greder Racing Team, das NART-Racing Team aus den USA, das Martini-Racing-Team aus Deutschlandund natürlich auch das unverwüstliche David Piper Auto Racing-Team aus England.
Es scheint, dass insgesamt 41 Rennfahrer an den Dreharbeiten beteiligt waren, darunter Semi-Profis und Privatfahrer, wie z.B. Rob Slotemaker, Dieter Spoerry, Guy Chasseuil, Arthur Blank, Toine Hezemans, Hugues de Fierlant, Claude Ballot-Lena,Teddy Pilette, Herbert Müller, Helmut Kelleners und Jean Sage, welcher ein paar Jahre später der langjährige Sportdirektor des Renault-Formel 1-Teams werden sollte. Heute ist kaum noch jemand von ihnen bekannt, für Laien schon gar nicht, aber alleine ihre Verpflichtung wäre schon eine Sensation gewesen.

Darüber hinaus wurden aber auch ein gutes Dutzend aktueller Profirennfahrer engagiert, allesamt absolute Legenden. Unter ihnen waren sowohl ehemalige, als auch zukünftige Le Mans Gesamt- und Klassensieger, wie z.B. Masten Gregory (Gesamtsieger 1965 plus Klassensieg 1961), Jacky Ickx (Gesamtsieger 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 und 1982!), Richard Attwood (Gesamtsieger 1970), Gérard Larrousse (Gesamtsieger 1973 und 1974 plus Klassensieg 1969), Derek Bell (Gesamtsieger 1975, 1981, 1982, 1986 und 1987!), Jürgen Barth (Gesamtsieger 1977 plus Klassensieg 1972, 1978, 1981 und 1993), Vic Elford (Klassensieg 1967 und 1973), Brian Redman (Klassensieg 1978 und 1980), Rolf Stommelen (Klassensieg 1966, 1968 und 1976), Joseph „Jo“ Siffert (Klassensieg 1966 und 1967), der Renningenieur und Ferrari-Werksfahrer Mike Parkes (Zweitplatzierter 1961 und 1967 plus Klassensieg 1967, sowie Drittplatzierter 1963) und der Porsche-Werksfahrer Herbert Linge (Klassensieg 1960, 1961, 1963 und 1965). Letzterem kam eine ganz besondere Rolle zu, denn er war nicht nur der zweite Fahrer des in der ersten Runde der 24 Stunden von Le Mans 1969 tödlich verunfallten John Woolfe (siehe oben). Nein, im echten Rennen um die 24 Stunden von Le Mans 1970 fuhr er den Kamerawagen, einen Porsche 908/01 Spyder, zusammen mit Jonathan Williams unglaublicher Weise auf den 9. Gesamtrang! Und dies trotz des zusätzlichen (Kamera-) Gewichts und trotz der ständigen Stopps zum Wechsel der Filmrollen.

Gut, man könnte anführen, dass die meisten dieser Fahrer ohnehin bereits in der Gegend waren, weil sie eben auch schon im Juni 1970 Teilnehmer der echten 24 Stunden von Le Mans waren.
Es beeinträchtige ihren Einsatz aber nicht im Geringsten, dass sie bereits ein 24 Stunden Rennen in den Knochen hatten, als sie sich im Anschluss daran, in den Dienst des Filmes stellten. Und das, trotz einer weiterhin auf Hochtouren laufenden Rennsaison 1970. Das Solar Productions ihnen dann kurzentschlossen den Privatjet zur Verfügung stellte, war sicherlich eine logistische Erleichterung für die Rennfahrer, die ja noch ganz andere Verpflichtungen hatten. In dieses spezielle Flugzeug-Logbuch würde ich gerne mal schauen. Wahrscheinlich stand es während der gesamten Dreharbeiten nur zum Nachtanken am Boden.
Mit David Piper fand sich, last but not least, auch der professionellste aller Privatfahrer an der Sarthe ein. Dieser hatte, als einer der ersten weltweit, das Thema Sponsoring durchdrungen, verstanden, und für sich genutzt. Der unerschrockene fünffache(!) Gesamtsieger der 9 Stunden von Kyalami und Klassensieger der 12 Stunden von Sebring 1964, 1965 und 1968, sprang als privater Ferrari-Pilot öfters sogar mal markenübergreifend ein. Unvergessen ist bis heute, als sich 1969 die Porsche-Werksfahrer Dieter Quester und Armin Hahne nach Abschluss des Nürburgring-Trainings weigerten, den Porsche 917 (Fahrgestellnummer #917-004) beim Hauptrennen, den 1000km vom Nürburgring, zu fahren weil der Wagen eine „Todesfalle“ sei. Gut, er war eine Todesfalle. Aber das hielt David Piper und Frank Gardner nicht ab, einzuspringen und mit diesem Wagen noch den achten Gesamtrang (Klassenzweite!) zu erzielen. Dieses Resultat konnte man gar nicht hoch genug wertschätzen, denn ernsthaft fahrbar, d.h. schnell, wurde der 917 erst durch die darauffolgenden Änderungen am Fahrgestell. Womit wir beim Thema wären. Jene Gruppe von Beteiligten, welche, wahrscheinlich wie keine zweite, sichtbar zur Legendenbildung beitrug und für die nachhaltig authentische Wiedergabe eines Renngeschehens innerhalb dieses Filmes sorgte. Die Rennwagen!
Steve McQueens Produktionsfirma Solar Productions hatte für das Filmprojekt in ganz Europa Rennwagen zusammengesucht und in seiner Vorstellung sollte er, der Hauptdarsteller, einen Gulf-Porsche 917 fahren. Wir erinnern uns: Jenes Fahrzeug, welches er im Jahre 1970 gerne bei den echten 24 Stunden von Le Mans gefahren hätte. Es war der Schweizer Rennfahrer Joseph „Jo“ Siffert, der die Gunst der Stunde am schnellsten erkannte und seinen Assistenten Paul Blancpain beauftragte, Kontakt zu Solar Productions herzustellen. Man traf sich und ging die Liste der benötigten Fahrzeuge durch. Siffert sagte zu, er könne alle geforderten Rennwagen zeitnah liefern, inklusive der benötigten Gulf-Porsche 917. Das war schon ein kleines Husarenstück, denn von den insgesamt zehn georderten Rennwagen besaß Siffert zu diesem Zeitpunkt nur ein Exemplar: Seinen eigenen Gulf-Porsche 917. Aber dennoch war das kein nennenswertes Problem, denn inzwischen waren Siffert und McQueen ja befreundet. Und beide trugen bereits ein hohes finanzielles Risiko.

Zum Glück für Siffert stellte sich schnell heraus, dass die Amerikaner zwar über ein unlimitiertes Budget verfügten, aber offenbar keine Ahnung von Rennwagen hatten. Sicherlich auch, um Zeit zu gewinnen, kaufte sein Assistent Blancpain in der Schweiz vier gebrauchte Straßen Exemplare des Porsche 911, einen Porsche 914/6 und eine Chevrolet Corvette. Und zwar zu einem Bruchteil jenes Preises, welchen echte Rennversionen dieser Modelle gekostet hätten. Diese Strassenwagen wurden dann flugs zu Franco Sbarro nach Genf gebracht, der sie in glaubwürdige Rennversionen umbaute und beklebte. Anschließend wurden diese Fahrzeuge zum Rennwagen-Preis an Solar Productions weiterverkauft.
Wenn diese speziellen Fahrzeuge angekauft worden wären, um sie in echten Rennen einzusetzen, wäre dieses Vorgehen sicherlich Betrug gewesen. Hier fiele mir aber eher das Wort „Chuzpe“ ein, denn für die Darstellung eines Starterfeldes in einem Rennfilm reichten diese Wagen ja locker aus.
Wie auch immer man das finden mag: Mit diesem kleinen Schurkenstück haben wir nun genügend Gelassenheit an den Tag gelegt, um uns dem anzunähern, was man getrost als den Kern dieses Filmes bezeichnen könnte: Die Akquise des qualitativ hochwertigsten Rennwagen-Filmfuhrparks aller Zeiten!
Der aufmerksame Leser hat natürlich längst bemerkt, dass wir uns nun einem Teilbereich des Filmes annähern, der so komplex und speziell ist, dass sich in der Leserschaft gleich sehr wahrscheinlich die Spreu vom Weizen trennen könnte. Tatsächlich bewegt sich der folgende Bereich irgendwo zwischen Automobilforensik und -archäologie, was absurd anmuten mag, wenn man bedenkt, dass die betreffenden Vorgänge ja erst um die 50 bis 60 Jahre zurückliegen. Zu meiner Entlastung möchte ich jedoch anführen, dass wir ja immerhin auf der Suche nach einer Begründung sind, warum gerade dieser Film möglicherweise nichts weniger, als der beste Rennfilm aller Zeiten sein könnte.
Fest steht: Im Rahmen der Recherche zu den Begleitumständen der Dreharbeiten zu Le Mans, oder zum Film selbst, konnten von mir achtundzwanzig mehr oder minder beteiligte Vollblut-Rennwagen ausgemacht werden, es gibt aber auch Quellen, die von fünfundzwanzig Stück sprechen. Wie dem auch sei: Weil wir es hierbei mit absoluten Fahrzeug-Superlativen zu tun haben, könnte man Le Mans kaum gerecht werden, wenn wir an dieser Stelle nicht genau so tief in die Informations- oder Anekdotenlage abtauchen würden, wie in den anderen Bereichen des Filmes.

Um in diesem Tohuwabohu nicht den Anschluss zu verlieren, braucht man ein tragfähiges Konstrukt. Die beteiligten Fahrzeuge stelle man sich also einfach als Darsteller mit eigenen Namen in Form der Fahrgestellnummer vor. Sie haben demnach individuelle Profile, Konfigurationen und Historien, respektive Lebensläufe und die größte Herausforderung bestand eindeutig in der Identifizierung der Gestaltenwandler unter ihnen. Ich hatte es also mit ausgetauschten oder umlackierten Karosserien zu tun und natürlich bestand immer die Möglichkeit, dass einzelne Fahrzeuge, je nach Bedarf und/ oder Verfügbarkeit, nicht nur auf eine Startnummer festgelegt waren. Dieser Umstand machte nicht nur die Recherche, sondern auch eine genaue Analyse der zusammengesammelten Daten und Informationen extrem kompliziert. Erschwert wurde es insbesondere auch dadurch, dass man aufgrund der späten Geburt weder bei den Dreharbeiten dabei war, noch Zugriff auf die originalen Le Mans Logistik-Unterlagen des Fahrzeugdisponenten hatte. Diesen Job hatte damals Andrew Ferguson übernommen. Der ehemalige Rennleiter und Manager des Lotus Formel 1-Teams hatte seinerzeit den Filmfuhrpark technisch und logistisch betreut, verstarb jedoch bereits 1982 an einem Herzinfarkt und stand daher nicht länger zur Verfügung.
Wir werden also frei zugängliche Quellen heranziehen, natürlich immer mit dem Restrisiko, dort auf Ungenauigkeit oder Fehler zu stoßen. Die absolute Pest sind da natürlich auch Quellen, die sich aufeinander beziehen oder im Widerspruch zu klar recherchierbaren Fakten stehen. Das ist das Spektrum, in dem man vor sich hin irrlichtert. Und als ob all diese Faktoren noch nicht kompliziert genug gewesen wären, stellten vorsätzlich getauschte Fahrzeugidentitäten natürlich ebenfalls ein Problem dar, z.B. aufgrund eines Rennunfalls oder der Vermeidung von zollrechtlichen Problemen bei einem Grenzübertritt. Doch auch damit noch nicht genug: Zu diesem interdisziplinären und mehrdimensionalen Puzzle gesellten sich dann noch Automobilhistoriker, die sich bis heute leider nicht auf eine logische Benennung der betreffenden Wagen einigen konnten.
Um hier eine einigermaßen sichere Identifikation der an den Dreharbeiten zu Le Mans beteiligten Wagen sicherstellen zu können, kann der Leserschaft eine kleine Exkursion in die Bezeichnungen leider nicht erspart werden. Denn ein Großteil der besagten Historiker, in Büchern oder dem Internet, benannten ein Fahrzeug zuerst nach seiner (leider jederzeit auswechselbaren!) Identität und fügten dieser Bezeichnung erst dann die Nummer des physischen Beweises, d.h. des Fahrgestells, hinzu. Ein individueller Wagen wird bei ihnen beispielsweise zum „#917-026 (031)“, was in diesem Fall bedeutet: „Fahrzeugtyp 917 mit Fahrgestellnummernplakette/ Fahrzeugidentität #026, welche vom (physisch anwesenden) Fahrgestell #031 benutzt wird“.
Die etwas hakelige Dechiffrierung dieser Nummerierung ist hier eindeutig ein Indiz dafür, wie unnötig kompliziert und unlogisch diese Gliederung ist. Außerdem birgt sie die Gefahr, dass man Rennerfolge dem falschen Wagen zuordnet.
Also benenne ich zuallererst immer die Fahrgestellnummer, die fest mit dem physisch verbauten Fahrgestell verbunden ist und erst dann die neue Identität, sofern vorhanden. Und natürlich ist es sehr viel schwerer, ein komplettes Fahrgestell mit seiner angeschweißten Nummer (nächstes Bild) zu entfernen, als angenietete oder angeschraubte Fahrgestellnummernplaketten, d.h. die Identität zu verändern.

Denselben Wagen nenne ich also, vice versa: #917-031 (026-ID). Das bedeutet nichts weniger, als dass das im 917 physisch verbaute Fahrgestell die Nummer #031 trägt, es nun aber die Fahrgestellnummernplakette/ den Papieren/ der Identität des Wagens #026 benutzt.
Na super, erst die Länge des Textes, dann noch diese raumgreifende Erklärung. Die Stimmung ist sicherlich komplett im Keller, weil sich in der Leserschaft nun wahrscheinlich erneut Zweifel regen, ob man weiterlesen sollen oder nicht. Andererseits will man im Zweifel ja auch nicht den Überblick verlieren. Ein berechtigter Einwand, denn für „textüberfliegende Schnell- oder Zwischenleser“ könnte es gleich noch etwas weniger… hm… flauschig oder konsumfreundlich werden.
Deshalb nur Mut: FilmwissenschaftlerInnen, Fans und EnthusiastInnen, ErbsenzählerInnen und Rennwagen-Nerds können sich gleich auf sehr viel mehr Tiefgang freuen, als andere Texte zu diesem Thema bereitstellen. Insbesondere, und jetzt steigt der Blutdruck wieder an, wo es doch gegenwärtig ZWEI unterschiedliche Fahrzeuge gibt, die es auseinanderzuhalten gilt. Und beide waren indirekt oder direkt in den Film involviert: #917-031 (026-ID) und #917-026 (031-ID).
Gebt nicht mir die Schuld, ich mache das nicht, um euch zu ärgern. Tatsächlich war es das letztgenannte Fahrzeug, welches den Anlass dafür setzte, dass es heute zwei separate Fahrzeuge mit unterschiedlichen Historien gibt. Das folgende Bild aus dem echten(!) Rennen um die 24 Stunden von Le Mans 1970 zeigt jenen Moment, welcher sich auch auf die Fahrzeugdisposition innerhalb der Dreharbeiten zu Le Mans auswirken würde. Im Hintergrund sieht man zufällig auch den Porsche 908-Kamerawagen vorbeihuschen, der unablässig Filmmaterial im echten Rennen eingesammelt hatte. Dazu aber, wie schon gesagt, später mehr.

Ein letzter Hinweis den Persönlichkeitsschutz der beteiligten Besitzer betreffend: Alle folgenden Namen wurden bereits an anderer Stelle im Internet oder in Büchern veröffentlicht.
Ich werde mein Bestes versuchen und bitte angesichts der Komplexität und Vollständigkeit jedoch schon jetzt um Nachsicht, hier insbesondere auch bei den Lola– und Chevron-Fahrgestellnummern, zu deren individuellen Historien ich kaum öffentlich zugängliche Quellen fand. Informationen hierzu bitte ich also mit den nötigen Zweifeln zu betrachten. Aufgrund der überbordenden Thematik versuche ich mich bei den Details der einzelnen Fahrzeuge nur auf das Notwendigste zu beschränken. Für diesen Beitrag unnötige Details, wie z.B. Motor- und Getriebewechsel, inklusive ihrer laufenden Nummern, würden auch das sanfteste Lesergemüt strapazieren.
Falls in diesem Augenblick also noch vereinzelte LeserInnen an den Endgeräten verweilen sollten, gehe ich davon aus, dass an der bevorstehenden Ausarbeitung ein gewisses Interesse besteht. Sollte dies der Fall sein, möchte ich dennoch empfehlen, konzentriert zu lesen, damit entscheidende Informationen nicht durchrutschen. Statt den folgenden Text bei nachlassender Konzentration nur noch zu überfliegen, weil man vielleicht glaubt, endlich schnell zum Ende kommen zu wollen, möchte ich die Leser bitten, im Zweifel lieber eine Pause einzulegen. Dies im Hinterkopf behaltend und natürlich vorbehaltlich bezüglich der Vollständigkeit insgesamt, waren die an dem Film Le Mans beteiligten Rennwagen, nach bestem Wissen und Gewissen, namentlich wie folgt:
Porsche 917K (Fahrgestellnummer #917-022). Das „Star-Car“! Ursprünglich von der Porsche KG als Ersatzwagen eingelagert, wurde dieser weiß lackierte Wagen formal zunächst an Joseph „Jo“ Siffert verkauft, der hier als Mittelsmann für Solar Productions fungierte. Offenbar war es nicht das Werk, sondern Siffert selbst, der #917-022 für die Dreharbeiten in der Farbe Gulf-Hellblau mit orangem Streifen lackieren ließ. Nach dieser Anpassung verkaufte er #917-022 an Steve McQueens Solar Productions. #917-022 wurde jenes Fahrzeug, welches im Film von Michael Delaney (Steve McQueen) und seinem Co-Fahrer Josef Hauser (Stuntman Erich Glavitza) mit Startnummer „20“ gefahren wurde. Weil die Filmproduktion vorsah, Aufnahmen der echten 24 Stunden von Le Mans 1970 zu nutzen, wurde die Startnummer „20“ der Equipe Siffert/Redman gewählt, die im echten Rennen den Gulf-Porsche 917 mit Fahrgestellnummer #917-017 (004-ID) mit exakt demselben Farbschema gefahren hatte. Da #917-017 (004-ID) für die Dreharbeiten jedoch nicht verfügbar war, war aus #917-022 faktisch ein #917-017 (004-ID)-lookalike geworden und Jo Siffert wurde das Fahrerdouble von Steve McQueen.

Es gibt anscheinend Quellen, die berichten, dass #917-022 von Siffert ohne Motor und Getriebe an die Filmproduktion geliefert wurde. Allerdings widerspricht das folgende Bild dieser Information, denn es zeigt #917-022 fahrend. Die Gründe hierfür können mannigfaltig sein. Ein Grund könnte sein, dass wir es möglicherweise bereits schon hier mit einer umgeklebten Startnummer zu tun haben, respektive mit einem anderen Wagen als #917-022. Das wäre möglich, erscheint doch aber eher unwahrscheinlich. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass #917-022 von der Porsche KG tatsächlich ohne Motor ausgeliefert wurde. Vielleicht wurde er aber auch mit Motor ausgeliefert und Siffert könnte den Motor vor dem Weiterverkauf entfernt haben. Es wäre ihm zuzutrauen gewesen. Allerdings könnte im Falle eines motorlosen #917-022 auch ein Ersatzmotor aus den Beständen vom Gulf JWA/ John Wyer Automotive Engineering Ltd.-Team für die Dreharbeiten eingesetzt worden sein. Ja, bei derartigen Gedankenspielen merkt man den sich anbahnenden Knoten im Gehirn, denn es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Bekannt ist, dass die Porsche KG ihre Rennwagen üblicherweise immer OHNE Motoren verkaufte, weil sie in jeder Hinsicht das Wertvollste an einem Rennwagen waren. Man wollte potentielle Gegner ja nicht gerade mit dem besten werkspräparierten Material ausstatten. Aber vielleicht wurde auch eine Ausnahme gemacht und #917-022 hatte seinen Werks-Motor noch als er von der Porsche KG über Siffert an Solar Productions verkauft wurde. Immerhin hätte die Porsche KG im Zweifel dann zwei Rechnungen ausstellen können. Nachdem man diese Varianten nun bis aufs Kleinste durch den Wolf gedreht hat, verbleiben sie alle zwar im Bereich des Möglichen, aber vielleicht spricht das folgende Bild auch nur für sich selbst.

Bis genauere hierzu Informationen zur Verfügung stehen, gehen wir also von der Aktenlage aus. Und die lautet: Delaney, oder besser, McQueens Fahrerdouble Jo Siffert, fuhr den Wagen mit der Startnummer „20“, der laut Quellen von dem Porsche 917 mit der Fahrgestellnummer #917-022 dargestellt wurde. So weit, so klar. Auch, wenn das Skript für diesen Wagen etwas ganz Besonderes vorsah. Laut Drehbuch sollte Delaney am Steuer des Wagens mit der Startnummer „20“ während des Filmes nämlich in die Leitplanken crashen (der „Ping-Pong-Crash“). Da man jedoch auch 1970 schon wusste, dass man während einer in der realen Welt laufenden Rennsaison keine Originalrennwagen absichtlich zerstört, schon gar nicht, wenn es sich um Leihgaben von Privatfahrern oder aktiven Rennteams handelte, wurde der drehbuchkonforme Unfall natürlich nicht von #917-022 vollzogen, sondern von einem Double. Hierfür entfernte man die gelb lackierte Karosserie eines Lola T70 mit Startnummer „11“, erkennbar an den immer noch deutlich sichtbaren Füßen dieser Startnummer „11“ auf den Längsträgerverkleidungen, und stülpte dem verbleibenden fahrbereiten Lola-Chassis mit Fahrgestellnummer #SL76/141 (siehe weiter unten) eine originale Porsche 917 Karosserie mit Startnummer „20“ über. Welchem anwesenden 917er die Karosserie entnommen wurde, oder ob sie gar von #917-022 selbst kam, entzieht sich leider meiner Kenntnis, wie übrigens auch die Herkunft der anderen ausgewechselten Karosserien. Möglicherweise war es ja auch eine vom Gulf/John Wyer-Team mitgebrachte Ersatzkarosserie. Dieser als Double eingesetzte Hybrid war eines jener einer Handvoll am Set eingesetzten Exemplare und wurde vom Filmteam entweder „Porschola“ oder „Lolari“ genannt, je nach aufgesetzter Porsche– oder Ferrari-Karosserie (siehe unten). Nach dem „Filmunfall“ von Startnummer „20“ übernahm Michael Delaney jedenfalls den Porsche 917 mit der Startnummer „21“ von der Film-Equipe Johann Ritter (Fred Haltiner) und Peter Wiese (Peter Parten), der zunächst von #917-013, aber auch von #917-022 dargestellt wurde. Warum? Nun, als Delaneys Wagen durch den „Ping-Pong-Crash“ dramaturgisch aus dem Filmrennen war, wurde #917-022 nicht mehr mit der Startnummer „20“ benötigt. Da #917-013 während des Drehs mit Startnummer „21“ verunfallt war, bekam McQueens eigener #917-022 für die restlichen Dreharbeiten die Startnummer „21“ aufgeklebt. Zur Vermeidung von Anschluss Fehlern wurde #917-022 dann hastig in das Farbschema von #917-013 umlackiert: Neben der Anpassung des orangen Mittelstreifens im Frontbereich, wurden die ursprünglich orange lackierten Längsträgerverkleidungen von #917-022 nun in Gulf-Hellblau überlackiert, exakt wie es das Farbschema der Längsträgerverkleidungen von Ritters und Wieses ursprünglichen Film-917er (in der realen Welt jedoch zerstörten) #917-013 vorgaben. Auf dem folgenden Bild kann man sehr gut den überaus pragmatischen Ansatz der gewählten Lösung erkennen. Man kann erahnen, dass der Gestaltenwandel schnell und direkt vor Ort vollzogen wurde. Und er kam wohl aus der Sprühdose.
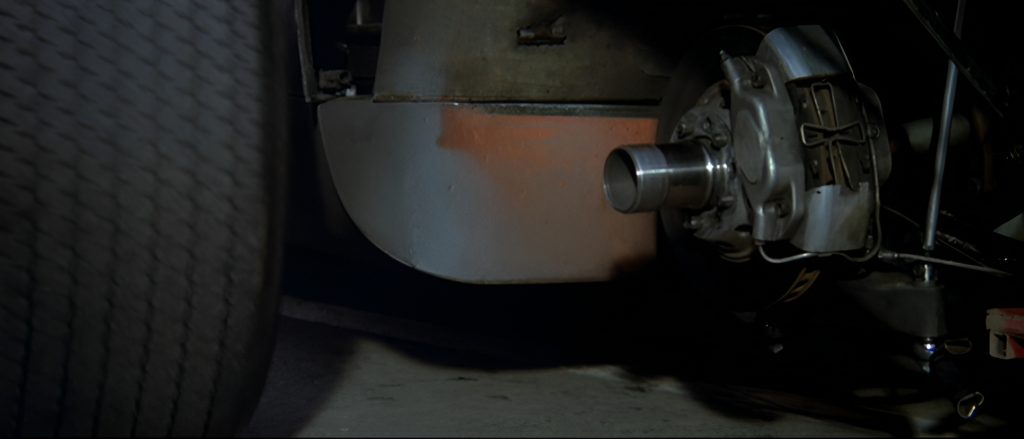
Eine Besonderheit zu allen anderen verwendeten Rennwagen am Set war, dass Steve McQueen die Fahrertür von #917-022 nach Beendigung der Dreharbeiten mit folgendem Text signierte: „Finished- Thanks for staying together- Steve McQueen“. #917-022 wurde anschließend an aktive Porsche 917-Fahrer der Endurance/ Interserie/ CanAm-Rennserien verkauft. Zunächst an Willi Kauhsen (1971), der das Farbschema ein wenig veränderte und #917-022 nun erstmalig im echten Rennbetrieb einsetzte, dann an Reinhold Jöst(1971), der den Wagen u.a. bei den 1000km von Buenos Aires 1971 einsetzte. Hierbei immer noch sichtbar: Die Signatur McQueens auf der Fahrertür.

1975 wurde #917-022 vom Rennfahrer Brian Redman gekauft, der knapp $ 15.000,- für den Wagen bezahlte, eine Summe, für die man damals einen nigelnagelneuen Mercedes-Benz 350SEL bekam.
In Redmans Besitz wurde der Wagen von David Piper restauriert und 1978 schließlich an niemand Geringeren als Richard Attwood verkauft, der den Wagen in jenen Porsche Salzburg-Farben (Rot mit weißen Flammen) lackieren ließ. Es war jenes Farbschema, welches auch der Porsche 917 mit Fahrgestellnummer #917-023 trug, in welchem Attwood zusammen mit Hans Herrmann Sieger der echten 24 Stunden von Le Mans 1970 wurde. In diesem Zustand verblieb #917-022 bis ca. 1990, als er endlich seine hell-blaue Gulf-Lackierung mit orangem Streifen zurückbekam. Im Jahre 2000 verkaufte Attwood den Wagen für $ 1.320.000,- an Frank Gallogly in New Jersey. Nach nur acht Monaten verkaufte dieser den Wagen an Bill Noon in San Diego, Kalifornien, dem Sammler und Händler der Symbolic Motor Cars. Nachdem der Schauspieler James Spader seinen Kumpel Jerry Seinfeld jahrelang damit aufgezogen hatte, dass in seiner (Seinfelds/ ed.) Porsche-Sammlung ausgerechnet ein Porsche 917 Rennwagen fehlen würde, entschied sich der Stand-Up Comedian im Jahre 2002, #917-022 zu erwerben. Noch vor der Covid-Pandemie im Jahre 2020 wurde der Wert dieses Fahrzeugs auf 30 Millionen Dollar geschätzt, heute wohl noch etwas mehr, aber wie man sehen kann, bewegt Seinfeld das McQueen-Auto immer noch artgerecht.

Porsche 917K (Fahrgestellnummer #917-013); Leihgeber: John Wyer/ Gulf Racing Team mit Startnummer „21“. Die Lackierung war Gulf-Hellblau mit orangem Streifen und der Wagen hatte (wie auch #917-024) ein Maschengitter am vorderen Lufteinlass. Dieses Fahrzeug fungierte bei den 24 Stunden von Daytona 1970 als Ersatzwagen und hatte bereits einen vierten Platz bei den 12 Stunden von Sebring 1970 auf dem Buckel, als er an Solar Productions verkauft wurde. Innerhalb des Filmes war #917-013 der Einsatzwagen mit der Startnummer „21“ und wurde von der Film-Equipe Ritter/Wiese gefahren. Wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, wurde der Wagen mit der Startnummer „21“ von zwei verschiedenen Porsche 917 dargestellt, #917-013 und #917-022. Und nachdem unser Filmheld Michael Delaney den Wagen im Film von der Equipe Ritter/Wiese übernommen hatte, erreichte er mit ihm den zweiten Platz.
Es scheint, als ob #917-013 aber auch eine andere wichtige Rolle übernommen hatte: Es gibt ein Foto, auf welchem er im vorderen Bereich mit einem von Gaylin Schultz entwickelten Stativsystem aus Aluminiumrohren ausgestattet wurde. Hierauf konnte eine Arriflex-Kamera entgegen der Fahrtrichtung den Cockpit-Bereich abfilmen. Dieses spezielle Fahrzeug könnte aber auch #917-024 gewesen sein könnte (ein Bild findet ihr weiter unten im Kapitel über #917-024). Es gilt aber als gesichert, dass das folgende Bild #917-013 zeigt, welcher am Heck mit einem ausladenden Rohrrahmen als Kameraträger ausgestattet wurde.
Dennoch bleiben Restzweifel, denn im Vergleich zu dem verschmutzten Vorderwagen und dem Längsträger, fällt der makellose Zustand der Heckhaube auf, die offensichtlich ausgetauscht worden war, offenbar kamen solche Replacements tatsächlich vor. Aber zurück zum Rohrsystem. Auch das Trägersystem am Heck ging auf eine Idee von Gaylin Schultz zurück. Selbst wenn man nicht auf eigene Rennerfahrungen mit einem perfekt abgestimmten Porsche 917 zurückgreifen kann, kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich dieses Ungetüm mit seinem aus dem Lot gewanderten Schwerpunkt gefahren haben muss. Und als zusätzliche Herausforderung addiere man dann noch das Renntempo hinzu.

Als Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Wagens mit der Startnummer „21“ benötigt wurden, fragte man David Piper, ob er #917-013 für die Kamera am Limit bewegen würde, während der Wagen dabei von außen gefilmt wird. Piper besaß seit über einem Jahr einen eigenen 917 (siehe #917-010), also sagte er zu. Die Aluminium-Trägersysteme für die Kameras wurden demontiert und David Piper machte sich auf den Weg, Runde um Runde und immer vom filmenden Ford GT40-Kamerawagen verfolgt. Im Streckenabschnitt Maison Blanche/ Whitehouse Corner verlor Piper bei ca. 275km/h die Kontrolle über #917-013 und schlug nahezu ungebremst in die Leitplanken ein. Die gesamte vordere Sektion wurde zerschmettert, ab Vorderkante Fahrersitz zerbrach der Wagen einfach (siehe Foto).
Zitat David Piper: “I was sitting in half a car, surrounded by smoke and dust, and I thought, Good Lord, that’s my shoe over there, and my foot is still in it.”

Wie durch ein Wunder überlebte David Piper diesen schweren Unfall, aber im Hospital musste sein rechtes Bein unterhalb des Knies amputiert werden. Im Abspann des Filmes weist eine spezielle Danksagung auf dieses Opfer hin: „And Special Appreciation to David Piper for his Sacrifice During the Filming of this Picture“. Die kläglichen Überreste von #917-013 wurden zur Porsche KG gebracht und in brauchbare Einzelteile zerlegt. Es ist unklar, ob der Rahmen wieder vervollständigt wurde aber um das Jahr 1971/72 bekam er offenbar die Papiere von #917-034, vielleicht sogar die Fahrgestellnummernplakette #917-034, und wurde irgendwann in den 1970er Jahren als Fahrgestell #013 mit #034-Identität an den Porsche-Rennmechaniker Bill Bradley verkauft. Es scheint, als ob bei ihm die Spur dieses speziellen Wagens enden würde.
Hinweis: Da #917-013 jetzt aus dem Spiel war, hatte John Wyer und Gulf von der Porsche-Rennabteilung einen Ersatzwagen auf dem Reservefahrgestell #917-034 aufbauen lassen, welcher aus zollrechtlichen Gründen (Umgehung der Einfuhrsteuer bei Grenzübertritten) nun einfach die Fahrgestellnummernplakette und Identität des Unfallwagen #917-013 übertragen bekam.
Dieses Fahrzeug wurde #917-034 (013-ID) genannt und war physisch nicht an den Dreharbeiten beteiligt. Übrigens ebenso wenig, wie der Gulf-Porsche 917 mit der Fahrgestellnummer #917-016, welcher bei den echten 24 Stunden von Le Mans 1970 die Startnummer „21“ trug.
Aber nochmal zurück zur Film-Startnummer „21“. Weil es nämlich noch ausstehende Szenen für den Porsche 917 mit Startnummer „21“ gab, wurde diese Startnummer nach Pipers #917-013 Unfall auf McQueens eigenen #917-022 übertragen. Hierfür musste dann auch das #917-013 Farbschema auf #917-022 übertragen und angepasst werden (genaueres in Kapitel #917-022).
Aber als ob es bisher noch nicht kompliziert genug wäre, gibt es da ja noch das Gerücht, dass im Film auch der Porsche 917 mit Fahrgestellnummer #917-024 mit der Startnummer „21“ gefahren wurde. Da es mit #917-013 und #917-024 zwei Fahrzeuge am Set gab, die ein Maschengitter am vorderen Lufteinlass hatten, habe ich keine Ahnung, welches Fahrzeug auf dem folgenden Bild zu sehen ist, nehme aufgrund der Position der Ziffern der Startnummer aber an, dass es #917-013 ist.

Porsche 917K (Fahrgestellnummer #917-024); Gulf-Hellblau mit orange lackiertem Dach. Wie #917-013, trug auch #917-024 eines der seltenen Maschengitter, welches den vorderen Lufteinlass schützte. Außerdem war #917-024 das einzige Fahrzeug am Filmset, welches keine NACA-Belüftungsöffnungen an den Dachseiten der Heckhaube hatte und es war eines der wenigen Fahrzeuge, das Joseph „Jo“ Siffert zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wirklich auch gehörte, als er es an Solar Productions verlieh. Auch über diesen Wagen wurde berichtet, dass er angeblich keinen Motor hatte. Das er im ersten Filmviertel mit Startnummer „22“ durch das Fahrerlager geschoben wurde, spräche deshalb auch tatsächlich für einen fehlenden Motor. Allerdings wurden ja auch Fahraufnahmen eines Wagens mit der Startnummer „22“ benötigt, weil er im Film von der Equipe Larry Wilson (Christopher Waite) und Paul-Jacques Dion (Jean-Claude Bercq) zum Sieg gefahren werden musste. Daher gab es am Filmset zwei Fahrzeuge, die das Farbschema Gulf-Hellblau mit orangem Dach und die Startnummer „22“ hatten. Unterscheidbar waren sie wie folgt: #917-024 hatte, wie schon gesagt, keine der üblichen NACA-Öffnungen an den Dachseiten der Heckhaube, während #917-031 (026-ID) welche hatte. Wenn man mal ignoriert, dass Heckhauben auch ausgewechselt werden konnten, und auch trotz der Annahme, dass mindestens eines der beiden Fahrzeuge keinen Motor gehabt haben soll, konnte man im Film aber doch beide Wagen mit Startnummer „22“ fahren sehen: Im späteren Verlauf des Filmes sah man auf der Rennstrecke deshalb sowohl #917-031 (026-ID) mit NACAs, sozusagen „at full throttle“, als auch #917-024 ohne NACAs, wie dieser selbstständig an die Boxenanlage gefahren kommt.

Speziell diese Boxensituation spräche dafür, dass auch #917-024 einen Motor hatte. Daraus könnte man dann wiederum schließen, dass #917-024 im Film, wie vorher im Abschnitt #917-022 schon erwähnt, ebenfalls mit der Startnummer „21“(!) gefahren sein könnte. Hierfür hätte man ihn allerdings komplett umlackieren müssen (von Gulf-Hellblau mit orange lackiertem Dach auf Gulf-Hellblau mit orangem Streifen). Andererseits hätte man #917-024, auch in dem neuen Farbschema, immer noch an den fehlenden NACA-Belüftungsöffnungen an den Dachseiten der Heckhaube erkannt. Es sei denn natürlich, man hätte, wie schon gesagt, die Heckhaube gewechselt. Hypothesen über Hypothesen. Fakt war aber, dass man im gesamten Film keinen 917er mit Startnummer „21“ und fehlenden NACAs sehen konnte. Ich lege mich fest: #917-024 war vor der Kamera zu keinem Zeitpunkt in dem Farbschema Gulf-Hellblau mit orangem Streifen und Startnummer „21“ zu sehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass er dieses Farbschema hinter der Kamera trug und vielleicht kennt einer der LeserInnen ja einen Vermessungsingenieur, der die genauen Kurvenradien und Positionierungen der einzelnen Startnummern vermessen möchte. Aufgrund des kleinen Maschengitters am vorderen Lufteinlass könnte der Kameraträger auf dem folgenden Bild jedenfalls #917-013 oder #917-024 sein, wahrscheinlich eher letzterer. Es war daher eines dieser beiden Fahrzeuge, welches mit einem von Gaylin Schultz entwickelten Stativsystem aus Aluminiumrohren ausgestattet wurde, damit eine entgegen der Fahrtrichtung montierte Arriflex-Kamera den Cockpit-Bereich mit Fahrer abfilmen konnte, sozusagen in Form eines frühen „Action-Selfies“.

Was auch immer geschehen sein mag, und wie auch immer er während der Dreharbeiten eingesetzt war: Nach Beendigung der Dreharbeiten erschien #917-024 dann doch im Farbschema Gulf-Hellblau mit orangem Streifen! Das wissen wir deshalb, weil er in diesem Zustand auf diversen Ausstellungen gezeigt wurde. Dann fand sich dieser Wagen unversehens in einer traurigen Inszenierung wieder. Jo Siffert war am 24. Oktober 1971 bei einem Rennen in Brands Hatch tödlich verunglückt. Also wurde #917-024 mit Trauerflor geschmückt, und fuhr (oder „rollte“?) am 29.Oktober 1971 an der Spitze des Trauerzuges, und flankiert von seinen Rennfahrerfreunden, durch die Straßen von Sifferts Heimatort Fribourg in der Schweiz. 50.000 Bürger säumten die Straßen, um ihrem Idol das letzte Geleit zu geben.

1978 verkaufte Sifferts Familie #917-024 an Claude Prieur in Frankreich, der ihn in der Nähe von Paris einlagerte. 2001 holte Jo Sifferts früherer Assistent Paul Blancpain den Wagen aus der Vergessenheit und kaufte ihn. Schon ein Jahr später verkaufte er #917-024 an Jean-Pierre Clément,bevor er im Jahr 2017 auf einer Auktion komplett unrestauriert für $ 14.080.000,- an Dan Fields in Florida verkauft wurde. Obwohl dieser ihn leider restaurieren ließ, gilt #917-024 (zusammen mit #917-019, welcher bei den Dreharbeiten nicht anwesend war), in seiner Gesamtheit immer noch als einer der beiden originalsten Porsche 917.
Porsche 917K (Fahrgestellnummer #917-031 (026-ID) war der zweite 917 am Set im Farbschema Gulf-Hellblau mit orange lackiertem Dach und Startnummer „22“ und der Leihgeber war erneut das John Wyer/ Gulf Racing Team. Geplant war allerdings, dass Wyer der Filmproduktion seinen echten Teilnehmer der 24 Stunden von Le Mans, den Porsche 917 mit Fahrgestellnummer #917-026 und Startnummer „22“, zur Verfügung stellt. Da dieses Fahrzeug jedoch während des echten 1970er Le Mans Rennens einen Unfall hatte (einige Passagen weiter oben sah man ja bereits den verunfallten #917-026 senkrecht an einem Bergungskran hängen), fehlte der Filmproduktion nun ausgerechnet jenes Fahrzeug, welches im Film den Sieg einfahren sollte!
John Wyer und Gulf schalteten schnell: Von der Porsche-Rennabteilung ließen sie sich einen Ersatzwagen auf dem Reservefahrgestell #917-031 aufbauen, welcher aus zollrechtlichen Gründen (Umgehung der bei jedem Grenzübertritt fälligen Einfuhrsteuer) die Fahrgestellnummernplakette und Identität des Unfallwagen #917-026 übertragen bekam. Der neue Wagen hieß in der Folge #917-031 (026-ID) und wurde von Wyer direkt an die Fahrzeugdisposition von Solar Productions geliefert, wo er an Front und Heck mit einem von Gaylin Schultz entwickelten System aus Aluminiumrohren ausgestattet wurde, welches bis zu drei Arriflex-Kameras (zwei vorne und eine hinten) gleichzeitig aufnehmen konnte.

Nachdem #917-031 (026-ID) seine Funktion als Kameraträger beendet hatte, wurde das System aus Aluminiumrohren entfernt und der Wagen wurde auch vor der Kamera eingesetzt.
Wie aber schon an anderer Stelle erwähnt, hatten am Filmset zwei unterschiedliche Fahrzeuge die Startnummer „22“, #917-024 und #917-031 (026-ID) und sie waren bekanntlich an kleinen Details zu unterscheiden: So hatte #917-024 keine NACA-Belüftungsöffnungen an den Dachseiten der Heckhaube, während #917-031 (026-ID) welche besaß. Auch wenn man die Heckhauben jederzeit auswechseln konnte: In der zweiten Filmhälfte konnte der Filmzuschauer #917-031 (026-ID) dann auf der Rennstrecke entdecken, wo er, laut Skript und natürlich ebenfalls von der Equipe Dion/Wilson gefahren, zum Sieg fuhr (siehe hierfür auch Kapitel #917-024).
Nach Beendigung der Dreharbeiten wurde #917-031 (026-ID) zum John Wyer/ Gulf Racing Team zurückgebracht, wo er seine Gestalt veränderte und in Gulf-Hellblau mit orangem Streifen lackiert wurde. ImHerbst 1970 wurde der Wagen dann erstmalig in echten Rennen eingesetzt. Dies sogar mit Erfolg: Sieg in Imola und in Zeltweg. Ein absolutes Highlight war aber sein zweiter Platz bei den echten 24 Stunden von Le Mans 1971 (dieses Mal aber mit senkrechten Heckfinnen und Startnummer „19“). Anschließend wurde er zum Spyder umgebaut, umlackiert, und m.E. an Ernst Kraus in Garmisch-Partenkirchen verkauft. Dieser setzte ihn in der europäischen Interserie ein, bis er 1972 in Hockenheim verunfallte. 1973 wurde der Wagen dann an den Händler und Rennfahrer Vasek Polak in Los Angeles verkauft. Durch seine Hände ging nahezu jeder Renn-Porsche, der jemals in die USA verkauft wurde. Im Jahre 1988 kaufte ihn dann der Restaurator Kevin Jeanette in West Palm Beach, Florida, der ihn unmittelbar an Jeffrey W. Hayes in Pennsylvania weiterverkaufte. Unter seiner Ägide wurde #917-031(026-ID in seinen ursprünglich geschlossenen Gulf-Zustand zurückrestauriert. Jedoch nicht in den ursprünglichen Le Mans-Kameraträger mit seinem ausladenden System aus Aluminiumrohren, sondern in seine „1971 Le Mans Gesamtzweiter“-Spezifikation mit Heckfinnen. Lackiert wurde also in Gulf-Hellblau mit orangem Streifen und Startnummer „19“.

Bei den Daytona Classics 1993 wurde #917.031 (026-ID) dann von niemand Geringerem als dem Schauspieler und Rennfahrer Paul Newman gefahren. Der Schweizer Sammler und Rennfahrer Jean-Marc Luco kaufte den Wagen dann im Jahre 2004 und seit 2009 ist das Fahrzeug im Besitz von Roald F. Goethe aus Hamburg; seine ROFGO Collection voller Gulf-Rennwagen befindet sich allerdings in England.
Fußnote: Neben #917-031 (026-ID), heute mit Startnummer „19“, im Film mit Startnummer „22“, d.h. dem eben beschriebenen ehemaligen Filmfahrzeug, existiert heute auch der wieder neu aufgebaute #917-026. Nach seinem Unfall bei den echten 24 Stunden von Le Mans und seinem kleinen Ausflug am Kran, wurde dieser Wagen ebenfalls als Spyder umgebaut, umlackiert und mit der Fahrgestellnummernplakette, Papiere und Identität von #917-031 versehen! Auch dieser Wagen ist heute wieder in seinen ursprünglichen Zustand vor seinem Unfall zurückrestauriert, d.h. Gulf-Hellblau mit orangem Dach und Startnummer „22“. So, wie er im echten Rennen um die 24 Stunden von Le Mans fuhr, bevor er verunfallte, am Bergungskran endete und seine Filmkarriere zu Ende war, noch bevor sie richtig Fahrt aufnehmen konnte.

Seit 2012 war der neuaufgebaute #917-026 (031-ID) im Besitz von Shaun Lynn in England, bis er im Jahr 2023 für kolportierte 22 Millionen Euro an die Clockwork Collection des Luxusuhrenherstellers Richard Mille in Frankreich verkauft wurde. Obwohl #917.026 (031-ID) ein komplett anderes Fahrzeug mit einem komplett anderen Erscheinungsbild ist, existiert aufgrund der „vice versa“-Namensgebung eine sehr hohe Verwechslungsgefahr mit dem genuinen Filmwagen, dem #917-031 (026-ID).
Porsche 917 Langheck (Fahrgestellnummer #917-042); Leihgeber: Porsche Salzburg mit Startnummer „25“. Im echten Rennen der 24H du Mans 1970 fiel #917-042 mit Vic Elford und Kurt Ahrens aus. Er hatte hierbei denselben weißen Look mit den roten Markierungen auf den vorderen Kotflügeln, die er auch während des Filmrennens hatte, als der Wagen vom Start weg die spektakuläre Pace auf der Hunaudières-Geraden vorgab. Weil Porsche Salzburg es zur Auflage machte, wurde er im Film ausschließlich von Werksfahrer Herbert Linge gefahren. Ein Jahr später nahm #917-042 wieder bei den echten 24 Stunden von Le Mans teil, dieses Mal in Hans-Dieter Dechents Martini-Farben. Und genau so ist er heute im Porsche Museum zu sehen. Zu echtem Ruhm gelangte er aber eindeutig durch jene Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen, bei denen er sogar die Gulf-Porsche 917 einfach stehen ließ.

Porsche 917K (Fahrgestellnummer #917-010) hatte extra für den Film eine orange-rote Farbe mit Sandemann-Sponsor und Startnummer „18“ erhalten und stand während des Filmes ausschließlich im Fahrerlager, wo man ihn sehen konnte. Der Leihgeber war natürlich der Besitzer David Piper. Im echten 1970er Le Mans Rennen ein paar Wochen vorher, war #917-010 noch gelb mit roten Längsträger-Verkleidungen (sill-panels), dies allerdings ebenfalls mit Sandemann-Sponsor und ebenfalls mit Startnummer „18“. Falkenaugen erkennen diesen Wagen allerdings in den Filmaufnahmen des echten Rennens und somit auch im hinzugefügten Footage-Filmmaterial.
Heute (2024) ist Piper 93 Jahre alt und besitzt den inzwischen BP-grünen #917-010 immer noch. Dieser Wagen ist nicht nur der einzige „One Owner From New“-917, sondern besitzt als Einziger seiner Art auch noch eine komplett abnehmbare Frontpartie.
Porsche 917K Ersatzchassis (Fahrgestellnummer #917-032); Leihgeber: Porsche KG. War während der Dreharbeiten zu Le Mans nicht vor Ort, wurde aber im Porsche-Werk für den Fall der (Un-) Fälle zur Verwendung durch Solar Productions vorgehalten.
Inzwischen wurde dieses Ersatzchassis von einem deutschen 917-Spezialisten zu einem fahrbereiten und vollwertigen 917 ohne Renngeschichte aufgebaut. #917-032 wurde im Jahre 2022 an einen bisher noch unbekannten Sammler in Cornelius, North Carolina, USA verkauft.
Porsche 908/01 Flunder Spyder (Fahrgestellnummer #908-022), ein ehemaliges 908 Langheck Coupe, welches im Porsche-Werk in einen 908/01 Flunder Spyder umgebaut, weiß lackiert und im Dezember 1969 von Steve McQueens Firma Solar Productions geleast wurde. Nach kleinen lokalen US-Rennen, wurde #908-022 am 21. März 1970 von Peter Revson und Steve McQueen mit der Startnummer „48“ auf den zweiten Platz der 12 Stunden von Sebring gefahren, aufmerksame LeserInnen werden sich erinnern. Anschließend wurde er von weiß auf dunkel-blau mit weißem Längsstreifen lackiert und mit drei(!) statisch montierten Arriflex-Kameras ausgestattet, welche sowohl in Fahrtrichtung als auch rückwärtig ausgerichtet, unter aerodynamisch unproblematischen Abdeckungen montiert waren. Mit Startnummer „29“ nahm #908-022 als Kamerawagen am echten Rennen um die 24 Stunden von Le Mans am 15. und 16. Juni 1970 teil und belichtete circa 10.000 Meter Filmmaterial.
Fun-Fact: Trotz des Handicaps ständiger Boxenstopps aufgrund des Wechsels der Filmrollen, erreichten Herbert Linge und Jonathan Williams mit diesem Kameraträgers den neunten Rang im Gesamtklassement und wurden tatsächlich Zweitplatzierte in der Klasse der 3 Liter Prototypen.

Leider wurden sie nicht gewertet. Die Rennleitung begründete ihre Entscheidung damit, dass die ständigen Stopps aufgrund des Wechsels der Filmrollen einen geordneten Rennverlauf stören würden! Entgegen anders lautender Gerüchte wurde #908-022 ausschließlich, während der echten 24H du Mans 1970 eingesetzt, um Footage-Material zu filmen und ist seit 1975 im Besitz des deutschen Rennfahrers, Konstrukteurs und Sammlers August Deutsch. Der Wagen verfügt heute sowohl über seine weiße 1970 Sebring Karosserie wie auch eine extra neuangefertigte dunkelblaue Wechselkarosserie mit Kamerahutzen.
Porsche 908/02 Langheck Flunder Spyder (Fahrgestellnummer #908/02-005); der Besitzer war Hans-Dieter Dechents Martini Racing Team. Seit 1969 hauptsächlich mit einem kurzen Heck eingesetzt, erzielte er im echten Rennen der 24 Stunden von Le Mans 1970 den dritten Gesamtrang in Langheck-Konfiguartion. Mit diesem Langheck sah man #908/02-005 auch im Filmrennen durch das Bild wischen, er war allerdings ein „minor action vehicle“. Erneut war Jo Siffert als Mittelsmann aufgetreten und hatte #908/02-005 dann an Solar Productions verliehen. Nach den Dreharbeiten wurde der Wagen zunächst an Hans Grell (1970), Peter Monteverdi (1970er) und Ernst Schuster (1990er) verkauft. Anfang des Jahrtausends gehörte er niemand Geringerem als dem Erfinder und Patenthalter des expandierbaren Stents, dem Herzchirurgen Dr. Julio Palmaz. Im Jahre 2007 wurde #908/02-005 von Dr. Ulrich Schumacher in Deutschland gekauft, der ihn 2010 an die Firma Fica Frio Ltd. (Besitzer: Carlos Monteverde) auf Jersey verkaufte. Auf einer Auktion im Jahre 2014 zahlte Joseph S. Lacob in Atherton, Kalifornien dann $ 3.430.352, – für diesen Wagen. 2024 bot er #908/02-005 auf zwei verschiedenen Auktionen an. Auf ihnen wurden zwischen 4,7 und 5,7 Millionen Euro erwartet aber der Wagen blieb unverkauft.

Porsche 908 Langheck (Fahrgestellnummer #908-013); 1969 vom Porsche Werk bei den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt und Dritter im Gesamtklassement, bevor er zunächst an Jo Siffert, dann an Reinhold Jöst verkauft wurde, welcher #908-013 wiederum via Siffert an Solar Productions verliehen. In der Eröffnungssequenz wurde #908-013 in der Unfalltrauma-Szene als Delaneys letztjähriges Fahrzeug gezeigt, mit welchem er in demselben Unfall verwickelt war, in welchem der Ferrari-Werksfahrer Piero Belgetti auf Ferrari 312P tödlich verunglückte. Für diesen Filmauftritt wurde der weiße #908-013 mit der Startnummer „64“ versehen und grundsätzlich im Stil jenes Porsche 908 Langheck Coupe (Fahrgestellnummer #908-031) beklebt, der 1969 im echten 24-Stunden-Rennen Gesamtzweiter mit Hans Herrmann und Gerard Larrousse wurde.
Im Gegensatz zu #908-031 differiert jedoch die Anordnung der Ziffern der Startnummer „64“.
In der Unfalltrauma-Szene des Filmes bedeckt Startnummer „64“ ausschließlich die Tür von #908-013, während sie am #908-031 bis auf die Verkleidung des Längsträgers, der Sill-panels, herunterreicht. Das folgende Bild hat nicht die beste Qualität aber es zeigt einen Teil jener Wagen, die Siffert extra für den Film besorgt hatte. In der ersten Reihe ganz rechts (Pfeil) sieht man u.a. auch den Wagen aus der Unfalltrauma-Szene und hier erkennt man diese senkrechte Öffnung.

Im Jahre 1972 wurde #908-013 mit Startnummer „60“ Gesamtdritter bei den 24 Stunden von Le Mans und ist in dieser Konfiguration seit circa 50 Jahren im Besitz der ehemaligen Schlumpf Collection, dem heutigen Musée National de l´Automobile in Mulhouse, Frankreich.
Anmerkung: Das sehr ähnliche aussehende Porsche 908 Langheck Coupe mit Fahrgestellnummer #908-029 war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ebenfalls in Sifferts Besitz. Dieser unterscheidet sich vom #908-013 jedoch durch zwei waagerecht platzierte Bremsbelüftungsöffnungen an der Nase, während das 908 Langheck Coupe im Film eine waagerechte und eine senkrechte Öffnung besitzt, was auf Sifferts #908-013 als Filmeinsatzwagen schließen lässt. Oder war der Filmwagen doch Sifferts #908-029, der dann aber den Nose-Clip von #908-013 trug? Who knows.
Porsche 910 Coupe (Fahrgestellnummer #910-007). Ein ehemaliger Porsche-Werkswagen von 1967, der nach seinem Werkseinsatz an den Schweizer Rennfahrer André Wicky verkauft wurde. Über Jo Siffert wurde er an Solar Productions verliehen, damit auch dieser Rennwagen als Streckengegner eingesetzt werden konnte. 1977 wurde er über den Händler Rob de la Rive Box an Gerry T. Sutterfield in Florida verkauft. Seit den 1980er Jahren befindet sich #910-007 in den enthusiastischen Händen des Revs Institute von Miles Collier in Florida, USA.
Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (deutsch: Langheck) mit Fahrgestellnummer #1004/1024.
Dies war ein ehemaliger Ferrari– Werkswagen von 1970, der auf #1024 umnummeriert wurde, bevor er im selben Jahr an die Ecurie Francorchamps von Jacques Swaters verkauft wurde. Swaters verlieh den Wagen dann an Solar Productions. Im Film war es das Langheck-Fahrzeug mit der Startnummer „7“.

Und diese Startnummer „7“ blieb in Erinnerung: Mit #1004/1024 würde Stuntfahrer Rob Slotemaker auf der Zufahrt der Indianapolis-Kurve jenem verunfallten #1026 ausweichen, mit welchem der Stuntfahrer Mike Parkes für den Film gerade die Leitplanke geküsst hatte. Danach würde der 512S mit Startnummer „7“ die Kontrolle verlieren und durch das Martini-Werbeschild crashen. Diese Aktion blieb #1004/1024 natürlich erspart und man setzte seine originale Karosserie mit Startnummer „7“ auf ein originales Lola T70-Fahrgestell, möglicherweise #SL73/132 (siehe weiter unten).
Nach den Dreharbeiten wurde das karosserielose Fahrgestell #1004/1024 erst an Herbert Müller, dann an einen unbekannten Italiener in Turin verkauft, welcher #1004 möglicherweise in #1012 (oder #1016?) umnummerierte. Die Quellen widersprechen sich hier, weswegen sich der Wagen in diesem Zeitabschnitt ein wenig unübersichtlich darstellt. Im Jahre 1979 wurde #1004/1024, zusammen mit einigen originalen 512-Karosserieteilen, jedenfalls an den Ford-Designer Manfred Lampe verkauft. Lampe besaß seit 1976 auch #1036 (siehe weiter unten) und auch #1012, welcher ebenfalls ein separates Fahrzeug gewesen sein soll. Vielleicht wurden da aber auch nur ein paar Infos gemixt. Jedenfalls wurde #1004/1024 von 1991 bis 1999 mit Hilfe des Ferrari-Werkes und diversen Restaurationsbetrieben in England als 512S Kurzheck neu aufgebaut; 1999 gab es dann die werkseitige Bestätigung, dass es sich bei diesem Wagen wirklich um #1004 handeln würde. 2012 wurde er an Peter Read, USA verkauft und 2017 an Pierre Mellinger in der Schweiz. Seit Anfang 2024 befindet sich #1004/1024 bei dem Händler Max Girardo in London, der ihn seitdem zum Verkauf anbietet. Hatte ##1004/1024 während der Dreharbeiten noch das hübsche Coda Lunga (Langheck) Hinterteil, zeigt das Bild ihn in seiner heutigen Kurzheck-Spezifikation.

Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (Fahrgestellnummer #1026), Erstbesitzer war die Ecurie Francorchamps von Jacques Swaters. Im Gegensatz zu #1004/1024, wurde #1026 von Swaters an Solar Productions nicht verliehen, sondern verkauft. Anmerkung: In den echten 24 Stunden von Le Mans fuhr Derek Bell #1026 mit der Startnummer „7“ und crashte ihn. Nachdem er im Werk repariert worden war, bekam #1026 für den Film die Startnummer „8“. Interessanterweise hatte die Innenseite der Fahrertür dieses Wagens während des Filmes die Markierung „1048“, ein Hinweis auf den Ferrari 512S #1048 der Scuderia Filipinetti, der eigentlich aber gar nicht Teil der Dreharbeiten war. Vielleicht wurde ja auch nur die Tür von #1048 benutzt, quasi als Ersatzteil, aber wer weiß. Klar ist zumindest, dass Derek Bell während der Dreharbeiten als Fahrerdouble von Erich Stahler bei Höchstgeschwindigkeit mit #1026 nur wenige Zentimeter unter einer an einem Kran hängenden Plattform samt Panavision-Kamera, angegurtetem Kamera-Operator und Assistenten hindurchfuhr. Bell berichtete noch Jahre später von seinem mulmigen Gefühl bei dieser Harakiri-Aktion, denn die Fahrbahnunebenheiten hatten den Wagen in heftige vertikale Bewegungen versetzt.
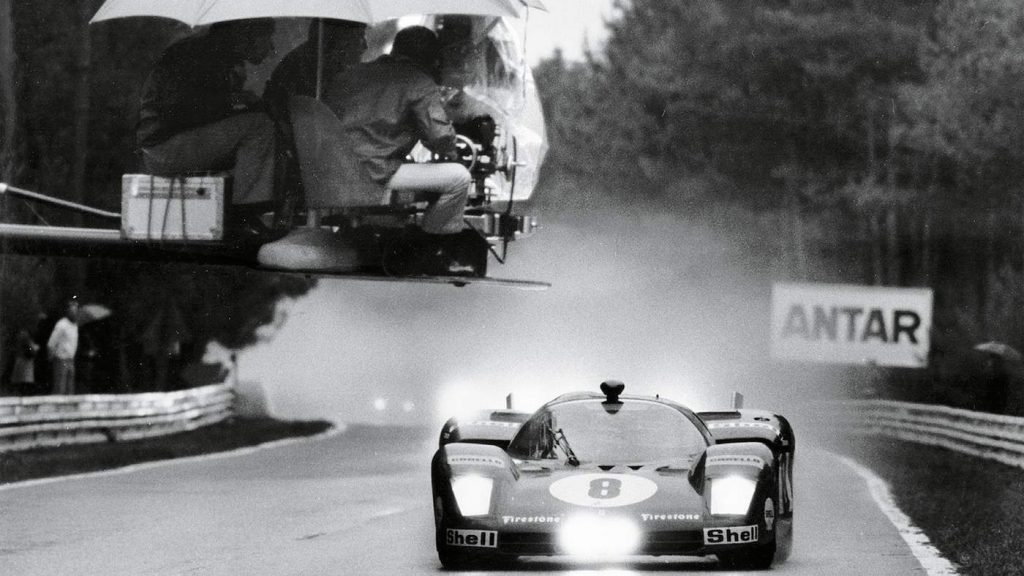
Kurz danach fing #1026 aus unbekannten Gründen Feuer und brannte komplett aus. Bell entkam dem Inferno unverletzt.
Hinweis: Es gibt Fotos eines Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga mit Startnummer „8“ und mit einem vorderen Aluminiumrohrsystem zur Montage einer Arriflex-Kamera. Unklar ist, ob dieses Foto vor, oder nach dem Feuer entstanden ist. Wahrscheinlich ist es #1026 aber genauso gut könnte nach dem #1026-Feuer auch ein anderes Fahrzeug mit dieser Startnummer versehen worden sein. Wenn dem so war, wäre mein Tip hier #1016 (siehe unten). Die Überreste von #1026 wurden zunächst an Herbert Müller, dann an einen französischen Schrottplatz-Besitzer und 1978 dann an den Pink Floyd-Schlagzeuger Nick Mason verkauft, der #1026 mit einem Standard-Kurzheck wieder aufbaute und ihn m.E. immer noch besitzt.
Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (Fahrgestellnummer #1028); Leihgeber: Luigi Chinetti/ North American Racing Team/ NART. Es scheint, dass der Wagen im Film die Startnummer „6“ hatte. Im Internet konnte ich kein Bild mit diesem Wagen finden aber das folgende Standbild aus dem Film zeigt ein Fahrzeug mit dieser Startnummer. Es war jener Wagen, mit welchem Vito Scalise (Michele Scalera) im Film den dritten Platz erreichte. Interessant ist, dass die Rolle des Scalise laut Skript auf den zweiten Platz fahren sollte. Die in diesem Skript verzeichneten Text-Revisionsdaten vom 10. September, 23. September und 24. September 1970 bezeugen, dass es in diesen 14 Tagen einen großen Bedarf an kurzfristig angesetzten Veränderungen gab, möglicherweise hatte David Piper in diesem Zeitraum seinen Unfall mit #917-013, so dass nicht nur die Fahrzeugdisposition, sondern auch das Schreiberteam darauf reagieren musste. Was auch immer die Gründe waren: Ein Jahr später, 1971, wurde #1028 vom inzwischen genesenen David Piper für den Besitzer David Weir und Chris Craft bei den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt, die mit Startnummer „16“ auf den vierten Platz im Gesamtklassement fuhren. Über Gordon Tatum, USA wurde #1028 im Jahre 1989 an Jeffrey Lewis, USA verkauft, der ihn 1996 an Harald Mergard in Deutschland weiterverkaufte.

Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (Fahrgestellnummer #1036); Leihgeber: Jacques Swaters/ Ecurie Francorchamps. Ein Ersatzwagen ohne Motor. Er wurde im Fahrerlager und an der Box durch das Bild geschoben, interessanterweise mit Scuderia Filipinetti-Farben und Startnummer „15“. Als typischer „Springer“ wurde #1036 während der Dreharbeiten mehrfach umlackiert, u.a. auch als Werkswagen. 1971 wurde der Wagen an Herbert Müller in der Schweiz verkauft, dann als Spyder umgebaut und bis Mitte der 1970er Jahre u.a. in CanAm Rennen in den USA eingesetzt. Seit 1976 ist auch #1036 im Besitz von Ford-Designer Manfred Lampe, USA und wurde als Ferrari 512M Berlinetta restauriert.
Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (Fahrgestellnummer #1008); Leihgeber: Georges Filipinetti, aus der Schweiz. Für eine Tagesmiete von zunächst Sfr. 1.000,-, später Sfr. 1.500, – an Solar Productions verliehen. Im echten 1970er Le Mans Rennen mit Startnummer „14“ verunfallt und repariert, rannte #1008 im Film ebenfalls mit Startnummer „14“. 1971 kam dann das Ende. Pedro Rodriguez fuhr mit #1008 am Norisring in Nürnberg und verunglückte tödlich. Heute gibt es eine recht gut gemachte Replica mit #1008-Identität.
Ferrari 512S Berlinetta Coda Lunga (Fahrgestellnummer #1016); Leihgeber: Georges Filipinetti, aus der Schweiz. Für eine Tagesmiete von zunächst Sfr. 1.000,-, später Sfr. 1.500, – an Solar Productions verliehen; im echten Rennen von Herbert Müller und Mike Parkes mit Startnummer „15“ gefahren und verunfallt, dann repariert und für den Film als Werkswagen mit Startnummer „5“ hergerichtet.

Im Film war #1016 u.a. jenes Fahrzeug, von welchem der Unterboden gefilmt wurde, als er im Fahrerlager aus dem Inneren des Scuderia Ferrari-Renntransporters auf die Laderampe geschoben wurde. Nach den Dreharbeiten wurde er an Herbert Müller in der Schweiz verkauft, der ihn, mit Standard-Kurzheck ausgestattet, in Rennen einsetzte und anschließend in die USA weiterverkaufte. Über Chris Cord (1971), Harley Cluxton III. (1979), Robert C. Rapp (1980s) nach England an Brandon Wang (1998) verkauft. Dann an Philippe Lancksweert, USA (1999) und über Jean Guikas (2000) und Olivier Cazalieres in Frankreich (2006?) an Carlos Monteverde in England und Monaco (2009) weiterverkauft. Im Jahr 2012 wurde #1016 von Franco Meiners in Padua, Italien erworben, der dem Wagen seine ursprüngliche Coda Lunga (Langheck-) Konfiguration zurückgab.
Anmerkung: Im April 1998 sah der Autor dieser Zeilen diesen Wagen in Paris, wo er ebenfalls aus seinem Renntransporter entladen wurde! Dieses Mal fand die Entladung jedoch am Port de La Bourdonnais am Ufer der Seine statt, direkt gegenüber vom Trocadero. Zu diesem Zeitpunkt hatte #1016 eine Straßen Zulassung aus Georgia, USA (Kennzeichen „38864 QD“). Er wurde angelassen, und brüllte mit Robson Waltons (CEO Walmart) originalem Shelby Cobra Daytona Coupe (Fahrgestellnummer #CSX 2286, Nummer 1 von weltweit 6 Stück!) im Formationsflug über die Seine-Brücke Pont d’léna und den Place de Varsovie, bis zum Startpunkt der Tour de France Automobile / Tour Auto, unterhalb des Trocadero! Zur Entspannung der Augen hier ein Symbolbild der Örtlichkeiten.

Niemals zuvor sah (oder hörte) der Autor so spektakuläre, oder auch nur entfernt ähnlich brutal laute Original-Rennwagen auf öffentlichen(!) Straßen. Es war wohl exakt dieser Moment, der dafür sorgte, dass jeder Klappenauspuff-Poser, der die Drehzahl seines Motors in den Begrenzer jagt, um einen extra von hochbezahlten Ingenieuren programmierten Fehlzündungsknall zu erzeugen, zu einem verständnislosen Kopfschütteln führen musste. Immerhin gibt es für sie längst keine technische Notwendigkeit mehr. Sie sind nur noch Fakes für Selbstdarsteller. Aber sehen wir erst einmal weiter.
Ferrari 312P Berlinetta (Fahrgestellnummer #0870); Leihgeber: Luigi Chinetti/ North American Racing Team/ NART. Während der echten 24 Stunden von Le Mans 1969 fielen Pedro Rodriguez und David Piper mit Startnummer „18“ aus. In der Trauma-Szene bezüglich dieses 1969er Rennens gibt es eine Durchsage, in welcher der Streckensprecher einen Unfall annonciert: Involviert seien der Porsche Nummer „64“ von Michael Delaney (#908-013/ siehe oben) und der Ferrari Nummer „18“ von Piero Belgetti, der als Folge des Unfalls leider in seinem Wagen verbrennen und deshalb Delaneys Trauma auslösen wird. Die im Filmfeuer lodernde Startnummer „18“ deutet auf den Ferrari 312P #0870 hin, wenngleich die in der Trauma-Szene aufgeblendeten Scheinwerfer eindeutig jene eines Ferrari 512S waren, also eines Fahrzeugs, welches es zum Rennen von 1969 noch gar nicht gab. Wie dem auch sei: #0870 wurde mit Startnummer „39“ für das echte Rennen um die 24 Stunden von Le Mans 1970 angemeldet, aber aus ungeklärten Umständen zurückgezogen.
Im Film-Fahrerlager und im Starterfeld wurde #0870 dann mit exakt dieser Startnummer „39“ durch das Bild geschoben. Noch im Jahr 1970 wurde #0870 an Pierre Bardinon in Frankreich verkauft, welcher in seinem Schloss aus dem 14ten Jahrhundert in der Nähe von Aubusson eine der beiden bedeutendsten Ferrari-Rennwagensammlungen der Welt zusammentrug. Nach seinem Tod im Jahre 2012 entbrannte ein Erbschaftsstreit zwischen seinen Kindern Anne, Jean-Francois und Patrick und Teile dieser Sammlung wurden von den französischen Behörden beschlagnahmt. Dieser Streit scheint noch nicht beigelegt zu sein, weswegen es spannend bleibt, wo und bei wem der Wagen wieder auftauchen wird.

Ferrari 312P Berlinetta (Fahrgestellnummer #0872); Leihgeber: Luigi Chinetti/ North American Racing Team/ NART. Bei den 24 Stunden von Le Mans 1969 fuhren Chris Amon und Peter Schetty #0872 mit Startnummer „19“. Wie etwas weiter oben bereits erwähnt, konnte Chris Amon in diesem Rennen nicht mehr ausweichen und traf den herausgerissenen brennenden Tank des verunfallten Porsche 917 von John Woolfe. #0872 ging sofort in Flammen auf, aber Amon entkam dem Inferno mit leichten Verbrennungen. #0872 wurde wieder neu aufgebaut, wurde 1970 Vierter bei den 24 Stunden von Daytona und Sechster bei den 12 Stunden von Sebring. Bei den 24 Stunden von Le Mans 1970 mit Startnummer „57“ konnte er sich nicht klassifizieren, weshalb #0872 während des Filmrennens mit eben dieser Startnummer durch das Fahrerlager und im Starterfeld geschoben wurde. 1972 wurde #0872 erstmal an Francois Sicard in Frankreich, und 1980/81 über Carle Conway in den USA und den Anwalt Paul Pappalardo, an den TV-Produzenten Greg Garrison in Montana verkauft. Schon 1982 wurde #0872 dann an Peter Sachs (Goldman&Sachs) weiterverkauft. Seit 2007 ist der Wagen bei Arnold Meier in der Schweiz, der ihn seitdem sowohl als geschlossene Berlinetta, als auch als Spyder einsetzt (Anmerkung: Im Jahr 2008 stand der Autor dieses Textes lästigerweise ein paar Rennmechanikern im Weg, als diese #0872 für ein Rennen am Nürburgring vorbereiten wollten. Hierbei drehte er dabei das kleine Documentary Short Feature „Craftsmanship“; verfügbar über den Die Medienhuren YouTube-Kanal).
Ford GT40 (Fahrgestellnummer #1074); Leihgeber: John Wyer/ Gulf Racing Team. 1968 war dieser Wagen noch das Siegerfahrzeug der 1000km von Monza. Danach blieben größere Erfolge aus, weswegen er 1969 an David Brown in Tampa, Florida verkauft wurde. Nach nur einem Jahr verkaufte er #1074 an Solar Productions weiter. Und die hatten große Pläne mit dem Wagen. Für die Dreharbeiten wurde dem Fahrzeug kurzerhand das Dach abgeschnitten und neue Bleche anstatt der Türen eingesetzt. Im Beifahrerbereich wurde eine pressluftbetriebene Stativansteuerung zur Montage zweier Arriflex-Kameras installiert. Wegen des erhöhten Gefahrenpotentials des Wagens, wurde ihm eine Teilnahme an den echten 24 Stunden von Le Mans 1970 untersagt. In dieser Form durfte #1074 also nur bei den Dreharbeiten benutzt werden. Wegen des fehlenden Daches erkannte der Fahrer Jonathan Williams die unverhältnismäßig große Torsionsanfälligkeit um die Längsachse des Fahrgestells und schätzte das Fahrverhalten des Wagens als zu unvorhersehbar ein. Deshalb wurde #1074 während der Dreharbeiten ausschließlich vom todesmutigen Rob Slotemaker gefahren. Auf dem Beifahrersitz dieser Höllenmaschine arbeitet der nahezu angstfreie Alex Barbey als Kamera-Operator.

Noch in den 1970er Jahren wurde #1074 als Gulf-GT40 zurückgebaut, restauriert und sofort an branchenbekannte Sammler und Händler in England und den USA verkauft: 1971 zunächst an den Händler Harley Cluxton III., 1974 an JCB’s Anthony Bamford,1979 wieder an Harley Cluxton III., 1979 an Steve Juda, 1980 an Robert Richmont, 1983 an George Stauffer, 1983 an den Händler Adrian Hamilton (dem Sohn des Gewinners der 24 Stunden von Le Mans 1953), der ihn erneut an Harley Cluxton III. weiterverkaufte, 1984 an den Rennfahrer und Sammler James Mazzotta und danach an Don Williams und seine Blackhawk Collection, 1995 an den Händler und Sammler Christopher Cox und 2003 schon wieder an Harley Cluxton III. Seit dem Jahr 2012 befindet sich #1074 bei dem Shelby- und GT40-Sammler Larry Miller in Boulder, Colorado, USA, der völlig entspannte 12 Millionen Dollar für das Schmuckstück bezahlte.
Chevron B16 (Fahrgestellnummer #B16-DBE27), Leihgeber: Jo Siffert, Schweiz.
Dieser Wagen wurde im Starterfeld während des Filmrennens eingesetzt.
Chevron B16 (Fahrgestellnummer #B16-DBE28), Leihgeber: Jo Siffert, Schweiz.
Dieser Wagen wurde im Starterfeld während des Filmrennens eingesetzt.
Chevron B16 (Fahrgestellnummer #B16S-70-01), Leihgeber: Jo Siffert, Schweiz.
Dieser Wagen wurde im Starterfeld während des Filmrennens eingesetzt. Mitte der 1980er Jahre im Besitz von Don Shead.
Chevrolet Corvette C3 Spider (Fahrgestellnummer #194679-S-706401) Leihgeber: Henri Greder via Jo Siffert, Schweiz; gelb. Dieser Wagen wurde während der 24 Stunden von Le Mans 1970 mit der Startnummer „2“ nicht gewertet und im Starterfeld während des Filmrennens eingesetzt.
Matra MS650 (Fahrgestellnummer #2), Leihgeber: Matra Sports. Im echten Rennen der 24 Stunden von Le Mans 1970 fiel dieser Werkswagen mit den Fahrern Jack Brabham und Francois Cevert und Startnummer „32“ aus. Im Filmrennen war er ein „minor action vehicle“ und wurde ausschließlich von Matra-Werksfahrer Jean-Pierre Jabouille gefahren, ebenfalls mit Startnummer „32“. Nach den Dreharbeiten wurde #2 anscheinend Sieger (oder doch Zweiter?) der Tour de France Automobile 1970 (die Quellen sind auch hier etwas widersprüchlich). Sicher ist, dass der Wagen aber 1971 bei der Tour de France Automobile siegte. Heute befindet sich #2 in der nichtöffentlichen Clockwork Collection des Luxusuhrenherstellers Richard Mille in Frankreich, wird aber von ihm in historischen Motorsportveranstaltungen eingesetzt.

Alfa Romeo Tipo 33/3 Spider (Fahrgestellnummer #75080-007) Leihgeber: Auto Delta. Beim echten Le Mans Rennen 1970 war dieser Wagen unter Rolf Stommelen und Nanni Galli mit Startnummer „35“ ausgefallen. Während des Filmrennens wurde er als „minor action vehicle“ mit Startnummer „36“ eingesetzt. Im Jahr 2022 wurde dieser Tipo 33/3 Filmwagen in Monaco für € 1.636.250, – versteigert. Das auktionierte Fahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt aber die Fahrgestellnummer, respektive die Identität, von #AR105-80*023*. Individualisierte Rennaufzeichnungen bezüglich einzelner Tipo 33-Fahrgestellnummern sind nicht überliefert, aber es sieht so aus, als ob ein Wagen mit Fahrgestellnummer #AR105-80*023* wohl die Targa Florio 1971 gewonnen hatte. Das war scheinbar aber ein separates Fahrzeug. Ohne Zugriff auf Werksunterlagen und spezialisierte Archive verschlingen die Auseinandersetzungen mit Identitätswechseln von Alfa Romeo-Rennwagen dieser Ära aber zu viel Lebenszeit für zu wenig Ertrag. Weil ich es bereits mehrfach versucht habe, kann ich sogar sagen: In diesem hochspezialisierten Fachgebiet gibt es kaum etwas, was mehr frustriert, als die Recherchen zu diesem speziellen Rennwagentyp.
Lola T70 Mk III GT (Fahrgestellnummer #SL76/150). Dieses Fahrzeug wurde 1969 neu an David Piper verkauft und in seiner Hausfarbe BP-Grün lackiert. Nach erfolgreichen Renneinsätzen stellte er das Fahrzeug 1970 Solar Productions zur Verfügung. Obwohl Piper die Anweisung gab, dass #SL76/150 bei den Dreharbeiten nur von Richard Attwood gefahren werden darf, fuhr auch der holländische Driftkünstler und Rennfahrer Rob Slotemaker mit diesem Fahrzeug (Startnummer „17“). Er war es, der mit diesem Wagen die phantastischen Schleudermanöver vollführte, die man im Film sehen konnte. 1971 wurde das Fahrzeug zunächst an Pierre-Henri Archambeaud, 1975 dann zurück an David Piper verkauft. 1979 wurde #SL76/150 an verschiedene Rennfahrer und Sammler in den USA, Schweden verkauft, bis ihn schließlich Shaun Lynn in England erwarb. Um die originale T70-Karosserie zu schonen, wurde eine neue Karosserie angefertigt. Im Jahr 2024 wurde #SL76/150 vom Londoner Händler Gregor Fisken zum Verkauf angeboten. David Piper ist zwar nun 93 Jahre alt, aber er wird sein altes Schlachtross doch nicht etwa schon wieder zurückkaufen wollen?

Lola T70 Mk III GT (Fahrgestellnummer #SL73/105). Ein Wagen, der 1967 an den Engländer Michael de Udy verkauft wurde, 1968 dann an David Prophet und 1970 zurückverkauft an Eric Broadley (Lola Cars Ltd.), der ihn schließlich an Solar Productions verlieh, wo er mit einer originalen Porsche 917 Karosserie ausgestattet wurde. Dieser „Porschola“ wurde für den Unfall in der Arnage-Kurve benutzt. Anschließend wurde der Wagen repariert und an Egmont Dursch verkauft, der ihn im Jahr 1982 an Peter Gerster in Deutschland verkaufte.
Lola T70 Mk III GT (Fahrgestellnummer #SL76/141), war ein Fahrzeug des schwedischen Rennfahrers Ulf Norinder, der ihn an den Rennfahrer Robin Ormes verkaufte. David Piper erwarb das Fahrzeug und verkaufte es an Solar Productions weiter. Er wurde gelb lackiert und mit Startnummer „11“ beklebt und sowohl im Starterfeld benutzt als auch für einen heftigen Dreher in der Indianapolis-Kurve, wo er den Crash des „Lolari“ #SL73/134 auslöste (siehe unten). Danach wurde #SL76/141 mit einer Funkfernsteuerung(!) ausgestattet und die Lola T70 Karosserie wurde gegen eine originale Porsche 917 Karosserie mit Startnummer „20“ ausgetauscht (Herkunft unbekannt). #SL76/141 wurde also das Crash-Double des Porsche 917 mit der Fahrgestellnummer #917-022, um diesen weitaus teureren Rennwagen zu verschonen. Als #SL76/141 im Film zwischen den Leitplanken zerschellte („Ping-Pong-Crash“), waren auf den Verkleidungen der gelben Längsträger (Sill-panels) dieses „Porschola“ die Füße der Startnummer „11“ immer noch sichtbar (siehe nächstes Bild). Die Reste dieses Wagens wurden dann von Franco Sbarro gekauft und eingelagert. Irgendwann wurde #SL76/141 wieder in einen rennfähigen Lola T70 aufgebaut und geriet über Clive Unsworth und Martin Birrane (1998) ungefähr im Jahre 2005 in den Besitz von Stefano Rosina.

Lola T70 Mk III GT (Fahrgestellnummer #SL73/132), ein weiteres ehemaliges Fahrzeug von Ulf Norinder, welches 1970 über David Piper an Solar Productions verkauft wurde. #SL73/132 ist eines von zwei Lola T70-Fahrgestellen, welches mit einer originalen Ferrari 512S Coda Lunga Karosserie mit Startnummer „7“ versehen wurde. Ich vermute, dass es in beiden Fällen die originale Karosserie des 512S #1004 mit Startnummer „7“ war (siehe oben). Dieser „Lolari“ wurde ebenfalls mit einer Funkfernsteuerung ausgestattet und wurde in der Indianapolis-Kurve über eine als Sandwall getarnte Rampe zum Abheben gebracht, wodurch der Wagen zum Entsetzen der Crew nicht zentral durch das „Martini“-Werbeschild flog, sondern den weitaus härteren Rahmen dieses Schildes traf. #SL73/132 hatte sich zu weit vom Sender entfernt.
Da die Karosserie hierbei vollkommen zerstört wurde, ist anzunehmen, dass andere Aufnahmen mit dieser Karosserie vorher gedreht worden sind (siehe #SL73/134). Irgendwann wurde #SL73/132 jedenfalls wieder in einen rennfähigen Lola T70 aufgebaut und in Frankreich über Claude Martin und Jacques LePane (1978), sowie Pierre Brunet und Jean Velchere an Rene Giordano (1987) und an Pierre-Alain France verkauft. Im Jahre 2023 war er im Besitz von Martin Wachter.
Lola T70 Mk III GT (Fahrgestellnummer #SL73/134). 1968 als nacktes Fahrgestell an Sid Taylor in England verkauft, der ihn mit Werks-Ersatzteilen fahrfertig machte. Danach wurde er in einer Zeitungsannonce zum Verkauf angeboten und von David Piper gekauft, der ihn gleich an Solar Productions weiterverkaufte. Zunächst wurde dieser Wagen mit einer Arriflex-Kamera im Innenraum ausgestattet und im Starterfeld eingesetzt. Danach wurde Fahrgestellnummer #SL73/134 mit einer originalen Ferrari 512S Coda Lunga Karosserie mit Startnummer „7“ ausgestattet, möglicherweise mit derselben ex #1004-Karosserie, die danach auch #SL73/132 trug. Wie könnte wohl der diesbezügliche zeitliche Ablauf gewesen sein?
Von Stunt- und Rennfahrer Rob Slotemaker gefahren, wurde mit dem „Lolari“ #SL73/134 wohl die Zufahrt auf den Sandwall in der Indianapolis-Kurve gedreht, an welchem (Schnitt!) dann jedoch #SL73/132 abheben würde und in das Martini-Werbeschild crashen würde. Mit dem kleinen Unterschied, dass #SL73/134 bereits bei dieser Zufahrt auf den Sandwall beschädigt wurde. Nach den Dreharbeiten wurde auch dieser beschädigte Wagen von Franco Sbarro gekauft und eingelagert. Es heißt, dass ein junger Mechaniker aus Tours in Frankreich die Teile aller gecrashten Lola-Fahrzeuge aufkaufte, um einen rennfähigen Lola T70 daraus zu bauen. Auf dem folgenden Bild posiert der Chefkameramann René Guissart am beschädigten Fahrgestell von #SL73/134.

Am Ende stand fest, dass Jo Siffert der inoffizielle Gewinner der Dreharbeiten war. Solar Productions hatte ihm pro Woche $ 5.000,- Leasinggebühr für seine Fahrzeuge gezahlt; am Ende der Dreharbeiten sollen es $ 100.000, – gewesen sein. Inflationsbereinigt wären das heute (2024) knapp $ 800.000, -. Nicht übel für ein paar Telefonate mit Freunden.
Der Schweizer Rennstall-Besitzer Georges Filipinetti stellte ebenfalls seine Fahrzeuge bereit und belegte in diesem Spiel Rang zwei. Er bekam zunächst Sfr. 1.000, – pro Tag pro Fahrzeug.
Als Filipinetti jedoch andeutete, dass er eines seiner Fahrzeuge für die 9 Stunden von Kyalami am 7. November 1970 in Südafrika gemeldet hätte, bot Steve McQueen Sfr. 1.500, – pro Fahrzeug pro Tag, woraufhin Filipinettis Wagen auf wundersame Weise auch weiterhin für die Dreharbeiten in Le Mans zur Verfügung standen. Die mit allen Wassern gewaschenen Schweizer Füchse Georges Filipinetti und Jo Siffert nahmen während der Filmaufnahmen also weitaus mehr Geld ein, als ihre Rennwagen durch Prämien für Rennplatzierungen eingebracht hätten. Aber auch David Piper verdiente durch den günstigen Ankauf von Rennwagen und ihrem teuren Weiterverkauf eine stolze Summe. Wenn man dieses Geld jedoch seinem geleisteten Blutzoll gegenüberstellt, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob es ein guter Deal war.
Okay, die Recherchen zu diesem Rennwagen-Abschnitt wurde dann doch etwas ausführlicher und nahmen am Ende sehr viel mehr Zeit in Anspruch, als ich angenommen hatte. Falls ihr nach diesem Informations-Overkill noch dabei seid, und ihr diesen Film, und andere Filme dieser Ära auch, immer noch nicht gesehen haben solltet, holt es nach. Schaut sie euch an, bildet euch euer eigenes Urteil. Der Film Le Mans ist der Grund, warum das Logo des „bösen“ Mineralölkonzerns Gulf Oil zu einem Stück Popkultur geworden ist, die Farbkombination Hellblau und Orange war einfach unschlagbar auf den T-Shirts von hippen Teenagern. Sollte das Wort „Cool“ jemals wieder eine Reanimation benötigen, dann wohl am ehesten in diesem Zusammenhang. Hinzu kamen der coolste Mann der Welt als Hauptdarsteller plus der coolste Mann Deutschlands der 1970er Jahre als Nebendarsteller, ein paar der coolsten originalen Rennwagen (nicht nur ihrer Ära), sowie eine der coolsten Armbanduhren der Welt.

Apropos: Wie war es überhaupt möglich, dass eine Armbanduhr mit insgesamt nicht mal zwanzig Sekunden Screen-Zeit auf der Leinwand einen Kultstatus erreichen konnte? Möglich wurde es natürlich erneut durch den umtriebigen Jo Siffert. Er war Mitte des Jahres 1970 nämlich mal wieder auf der Suche nach einem Sponsor, um seine Rennfahrerkarriere noch etwas länger finanzieren zu können und er hatte durchaus etwas anzubieten: Immerhin war er ja nicht irgendein Freizeitfahrer, sondern hatte 1969 die 1000km von Zeltweg und 1970 die 1000km von Spa gewonnen. Außerdem wurde er 1970 jeweils Zweiter bei den 24 Stunden von Daytona und bei den 6 Stunden von Watkins Glen. Eine gar nicht mal so üble Verhandlungsbasis. Zufällig wünschte sich Jack William Edouard Heuer einen höheren Bekanntheitsgrad seiner Uhren und somit auch bessere Verkaufszahlen. Die Beiden trafen sich und mit ein wenig Geschick handelte Siffertein Honorar von Sfr. 25.000, – pro Jahr für sich aus. Dafür trug er fortan nicht nur die Armbanduhren von Heuer, sondern natürlich auch den berühmten Heuer-Aufnäher am Overall. Und jetzt der Clou: Nachdem Siffert während der Dreharbeiten nicht nur engster Berater, sondern auch das Rennfahrer-Double Steve McQueens geworden war, hatte es zur Folge, dass dieser nun ebenfalls Heuer Uhren und einen Rennoverall mit Heuer-Aufnäher tragen musste. Voilá, die Mischung aus Gulf-Farben auf einem Automobil, einer Uhrenmarke und dem coolsten Typen auf dem Planeten, war einfach der perfekte Sturm zur richtigen Zeit, da konnte nichts mehr schiefgehen. Eine win-win-win Situation einerseits, aber andererseits auch ein Beleg dafür, wie banal Kult entstehen kann. Und worauf er basiert. Im Jahr 2011 wurde der originale Michael Delaney-Rennoverall übrigens für $ 984.000, – versteigert und die originale Heuer Monaco, die Steve McQueen im Film Le Mans trug, wurde im Jahre 2012 für ambitionierte $ 650.000, – versteigert. Acht Jahre später erzielte dieselbe Uhr auf einer weiteren Auktion $ 2.208.000, -. Und 2020 sah dieses Original 2020 dann so aus:

Offenbar wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis es die Gegenstände aus diesem Film dauerhaft in Museen für Zeitgenössische Kunst schaffen, wenn sie da nicht sogar schon hängen, liegen und stehen. Natürlich inklusive der alten Rennwagen aus diesem Film und sehr wahrscheinlich über jenen Zeitpunkt hinaus, ab welchem das Verbrennen von Benzin „just for fun“ schon längst nicht mehr drin sein wird. Aber das ginge schon in Ordnung, denn alte (und noch ältere) Rennwagen befinden sich weltweit ja schon längst im Status von schützenswertem Kulturgut. Und hier gäbe es die Popkultur dann gratis dazu. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons und Keith Haring müssen sich warm anziehen, denn mit ihren Kunstwerken kann man wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß im Wohnzimmer haben und die Nachbarn ärgern. So viel zur kulturellen und künstlerischen Einordnung des Filmes.
Zurück zur eigentlich vollkommen irrelevanten Anfangsfrage: Ist Le Mans denn nun ein Film oder nicht? Hierzu war festzustellen, dass sich der Film Le Mans nur sporadisch innerhalb filmischer Rahmenbedingungen, Erzählungen oder Regeln bewegte. Vielmehr zog er seine Erzählungen und Dramaturgien ausschließlich aus den Beobachtungen des Rennablaufs. Das bedeutete in diesem Falle, dass nicht der Film den Rahmen der Erzählung vorgab, sondern dass das Rennen selbst der Ausgangspunkt aller Handlungen und dramatischen Vorgänge, aller Höhen und Tiefen sowie unerwarteter Wendungen war, welche dann von unzähligen Kameras abgefilmt, und vom Filmschnitt in eine nachvollziehbare Erzählung gebracht wurden. Für etwaige nachrückende Zuschauer, Filmstudenten und Filmwissenschaftler ist dieser Film daher viel einfacher zu verstehen, wenn sie das Rennen selbst nicht als Kulisse oder Handlungsort, sondern als eine Art Regisseur betrachten.

In dieser Betrachtung wären es dann die Rennwagen, welche die Rolle der kapriziösen Darsteller übernehmen, während die Rennfahrer nur als Statisten fungieren würden. Statisten wären sie insbesondere deshalb, weil sie keine Handlungsfreiheit besäßen, sie innerhalb ihrer Möglichkeiten zwar alles versuchen würden, Kontrolle zu erlangen, letztlich aber sowohl den Regeln des vorgegebenen Rahmens (hier das Rennen selbst), als auch dem Schicksal (wechselhaftes Wetter, fragile Technik, Missgeschicke anderer Fahrer usw.), ausgeliefert wären, und nicht den Fantastereien irgendwelcher Autoren. Vergleichbar jener Situation, als wenn menschliche Darsteller bei einem Außendreh nicht nur dem Wetter oder den Launen ihrer RegisseurInnen ausgeliefert wären, sondern auch den organisatorischen und logistischen Zwängen der Außenbühne oder auch der Ausleuchtung eines Beleuchters vor der Kamera.

Und trotz dieses experimentellen Aufbaus hatte Le Mans einen filmischen Anfang. Es war eine ganz normale Eröffnungssequenz, die den Charakter des Rennfahrers beim Zuschauer einführte und sie endete in jenem Moment, in welchem Delaney in Maison Blanche wieder in seinen Porsche 911 stieg und über die zu diesem Zeitpunkt noch öffentlichen Straßen in Richtung des Fahrerlagers weg fuhr.
Allerdings hört die Gemeinsamkeit mit Standardfilmen hier auch schon wieder auf. So hatte er, klassisch gesehen, keinen zweiten Akt. Andererseits verabschiedete sich Delaneymit seinem Erscheinen im Rennoverall in den Katakomben der Boxenanlage der Rennstrecke von der zivilen Welt und läutete so einen neuen erzählerischen Abschnitt ein. Zugegeben: Das war nicht ganz das, was man als einen Plot-Twist betrachten könnte. Hierunter würde man, vereinfacht gesagt, verstehen, dass eine überraschende Wendung eintritt. Eine Wendung, die eine ursprünglich erwartete Handlung, komplizierter und/ oder interessanter macht, eine Veränderung, die die Figuren dazu zwingt, ihr Verhalten der neuen Situation anzupassen. Und genau so etwas hatte der Film Le Mans an dieser Stelle nicht. Auch nicht in der Dramaturgie eines fiktionalen Filmes.
Aber in der Dramaturgie eines Rennens? Auf jeden Fall! Es war jener Twist, in welchem Delaney sich während des Rennens von einem langsameren Porsche 911 aus dem Rhythmus bringen ließ und seinen Porsche 917, sorry -seinen „Porschola“-, mit Startnummer „20“ an den Leitplanken verschrottete (der berühmte „Ping-Pong-Crash“). Für den Zuschauer waren die vermeintlichen Hauptdarsteller (Delaney und Wagen Nr. „20“) also bereits nach der Hälfte des Filmes überraschend aus dem Rennen.

Wie ging es nun weiter? Tja, von nun an widmete sich Delaney dem Rennfahreralltag eines „No Finishers“, denn das Rennen lief ab jetzt ja ohne ihn weiter. Jedenfalls bis zum nächsten Twist, den das Rennen vorgab: Nachdem sich nämlich der Zuschauer und auch der vermeintliche Hauptdarsteller mit dem vorzeitigen Rennende abgefunden hatten, bekam Delaney überraschenderweise eine zweite Chance und wurde auf einen anderen Wagen gesetzt. Zugegeben: Ein Handlungstwist, in welchem eine Atombombe am Horizont explodiert und so das Leben aller bisher gezeigten Filmcharaktere nachhaltig verändern würde, wäre sicherlich offensichtlicher gewesen. Ein Twist dieser Größenordnung wäre wirklich unübersehbar gewesen und wäre überaus dramatisch und mit großem Getöse durch Menschen und Mauern gedrungen, so das auch der letzte Zuschauer ihn nicht hätte übersehen können. Meiner Meinung nach bekam der Film mit der gewählten Lösung eine weitaus realistischere Wendung verpasst und hat dadurch… Moment… ich höre gerade meinen Redakteur, der sich etwas besorgt über das aufgezeigte Atombild geäußert hat.
Okay, um diese Vorstellung eines schrecklichen Bildes wieder einzufangen, zeigen wir nun ein Bild eines wunderschönen Wanderweges durch die luftigen Pinienwäldchen in der Nähe der Mulsanne Kurve. Und man kann den leichten Wind und das Stimmenmeer der Zikaden geradezu hören.

Fest steht: Ein „guter Film“ braucht auf jeden Fall eine packende Story, die den Zuschauer in den Bann zieht. Und weil Le Mans packend inszeniert wurde, konnte er genau so etwas aufbieten. Jeder, der das Gegenteil behaupten würde, hätte die Dramaturgie des Inhaltes, eines Rennens(!), nicht verstanden. Das wäre dann aber nicht das Versäumnis des Filmes, sondern würde eher mit ADHS oder sonstigen Einschränkungen beim betreffenden Zuschauer zusammenhängen. Halt jemanden, für den es wahrscheinlich auch in Ordnung wäre, wenn sich Biologen ohne Atemschutz an fremde Artefakte annähern… auch das erwähnte ich ja schon.
Gut, für das Label eines „guten Filmes“ bräuchte es neben einer glaubwürdigen Geschichte aber auch überzeugende Schauspieler und eine glaubwürdige Ausstattung. Aber auch das hatte Le Mans. Sogar so viel, dass man fast den Überblick verlieren konnte. Ob es nun die geschichtsträchtige Rennstrecke, die menschlichen oder die automobilen Darsteller waren: Hier war wirklich alles Gold, was glänzte. Und die Gegensätze haben ja auch ihren Reiz. Auf der einen Seite ist es das größte und älteste Automobilrennen der Welt, auf der anderen Seite hat sein Namensgeber, das beschauliche Örtchen Le Mans wunderschöne mittelalterliche Gassen und bietet auch für kultur- und geschichtsinteressierte Besucher außerhalb des Rennzirkus genügend Andockpunkte.

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Natürlich bekommt der Autor dieser Zeilen keinen Cent vom französischen Fremdenverkehrsamt oder vom Touristenbüro in Le Mans. Aber mal ehrlich: Reicht ein Hinweis auf dieses ruhige und beschauliche Kleinod in der französischen Provinz, um ein Interesse an diesem Film zu wecken? Und was wäre, wenn es vielleicht doch stimmt, dass der Film durch den einen oder anderen einprägsamen Dialog zugänglicher gewesen wäre? Immerhin blieb ja wirklich nur sehr wenig Text in Erinnerung. Aber auch hier: Jeder, der in einem Rennfilm private Dialoge erwartet, übersieht, dass die notwendige nüchterne Professionalität eines Rennbetriebes so nicht gewährleistet wäre. In der Realität könnte so eine Ablenkung sogar tödlich enden. Also sind Ablenkungen, welche nichts mit einem professionellen Rennablauf zu tun haben, auch in einem Rennfilm tabu, ganz einfach. Man könnte sogar sagen: Je reduzierter im Privaten, und je professioneller im Ablauf, desto näher ist ein Rennfilm an der Realität.

Auf der Suche nach Authentizität setzte Le Mans seinen Fokus also auf die Bilder, den Ton und die Musik, sowie natürlich den perfekten Schnitt dieser Gewerke, soviel steht fest. Und das scheinbar mit Erfolg, denn die Bildabfolgen brannten sich in die Gehirne ganzer Generationen ein. Sie wurden so einprägsam, dass dieser Film zu einem Teil der Filmkultur wurde, zu einem Kultfilm, aber auch zu einem festen Bestandteil der Rennsportwelt. Von der Fahrt im 911 am Anfang, über die Atmo, die fiebrige Stimmung, die Blicke und das Gulf-Farbschema der Porsche 917, bis zu Steve McQueen im Gulf-Rennoverall und zu seiner Armbanduhr. Mehr Einprägsamkeit hätte keine Dialogzeile geschafft.
Ich will es mal so sagen: Natürlich besitze ich keinen echten Porsche 917. Aber immer, wenn ich einen sehe, real, als Modell, auf Bildern, oder auf Filmmaterial aus dem Film, dann höre ich nicht nur das typische 1970er Musikthema von Le Mans sondern stehe plötzlich auch im Stau der Zuschauermassen, die sich auf die Rennstrecke zubewegen, sehe vor meinem geistigen Auge die verwirbelte Luft der Gischtschleppen, welche die Rennwagen hinter sich herzogen, nicht zu vergessen die Nahaufnahmen von den Bewegungen der Räder in den Radkästen. Ich sehe die fiebrige Bewegungsunruhe des 917er beim Herunterbremsen und das Eintauchen der Vorderachse. Und natürlich sehe ich, wie sie anschließend mit entlasteter Vorderachse, d.h. mit hochgestreckter Nase, ganz so, als ob sie sonst nicht genügend Luft bekommen würden, mit dem Heck schwänzelnd aus der Mulsanne-Kurve herausbeschleunigten. Es muss unglaublich gewesen sein.

Ist Le Mans also ein echter Film? Oh ja, eindeutig. Und zwar, weil er ein Anliegen hatte, immerhin transportierte er das Gefühl einer Ära. Er hatte genau das, was Film von Beginn seiner Existenz an versucht hatte: Einen möglichst glaubwürdigen und unterhaltsamen Einblick in eine Welt zu erlauben, die einem sonst verborgen geblieben wäre. Dieser Film war aber auch erneut ein Beleg dafür, dass zeitgenössische Kritiken, die Höhe der Zuschauerzahlen, oder ob er ein kommerzieller Erfolg war/ist, nichts über die Qualität eines Filmes aussagen können.
Es ist kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass Rennwagen- oder Motorsport-Enthusiasten Le Mans seit Dekaden längst als absoluten Meilenstein erkannt haben. Ebenso ist dem besonderen Umstand Rechnung zu tragen, dass es seit über 50 Jahren kein anderer Film geschafft hat, die Essenz dessen zu transportieren, was ein Rennenfahrerdasein ausmacht, Dokumentationen mal ausgenommen.
Filmhistoriker sollten also nicht länger Zeit in formalen Debatten darüber verschwenden, was ein „Film“ ist, oder zu sein hat, oder welchen Regeln er zu unterliegen hat. Le Mans führte das Genre des Unterhaltungsfilms am Nasenring durch die Manege, indem er die Regeln der Fiktion von der Realität durchbrechen ließ. Er gab eine Richtung vor, welcher alle anderen Rennfilme seitdem vergeblich versuchen zu folgen: Eine derartige Menge an legendären Rennwagen, die von echten Rennfahrern im echten Renntempo auf einer echten Rennstrecke fahren, ist in einer Filmproduktion seither nie wieder erreicht worden ist und kann tatsächlich auch nicht mehr erreicht werden. Das war offenbar nur in diesem relativ kleinen Zeitfenster möglich. Mehr noch: Da in der damaligen Gegenwart keine Spur einer sich anbahnenden Legende spürbar war, entledigte man sich nach Abschluss der Dreharbeiten folgerichtig auch der wertvollsten und eindrucksvollsten Requisiten. Sie waren noch keine Kunst. Nicht nur ihre Anschaffung hatte ein Vermögen verschlungen, sondern auch, wenn sie ungenutzt herumstanden. Also weg damit.

Es ist schon ein Drama: Inzwischen hätten wir ultrahochauflösende Digitalkameras, nur fehlt es inzwischen nicht nur an dem notwendigen Personal, sondern auch am Material. Vor allem fehlt es an furchtlosen Sammlern, die bereit wären, ihre 20 Millionen Dollar Porsche und Ferrari in einer Filmproduktion zu verheizen. Aufgrund der horrenden Versicherungsprämien dürfte es in Zukunft aber glücklicherweise auch weiterhin ausgeschlossen sein, dass originale Rennwagen in dieser Qualität und dieser Anzahl jemals wieder in einem Spielfilm so sehr an ihre Grenzen gebracht werden. Le Mans hätte wahrscheinlich in keiner anderen Zeit entstehen können. Auch aus diesem Grund haltet ihr beim Kauf dieses Filmes etwas in den Händen, was in der Filmwelt wirklich einmalig ist:
Die höchste Form von Authentizität, zu der eine dramaturgisch erzählte Filmgeschichte imstande ist. Der einzige Motorsportfilm, der seine eigene Referenz ist, defakto sogar sein eigenes Genre darstellt. Und wie der schreckliche Unfall David Pipers zeigte, stand die Gefährdungslage bei den Dreharbeiten jener eines echten Rennens in nichts nach. Mehr noch: Der an den Dreharbeiten beteiligte fünffache Le Mans Gesamtsieger Derek Bell erzählte noch viele Jahre später in einem Interview: „The making of the film was, in many ways, a lot more dangerous than the race itself!“. Eine authentische Aussage eines Profirennfahrers, die Steve McQueen sicherlich nicht nur zum Schmunzeln gebracht hätte, sondern auch die Bestätigung dafür wäre, dass er, Steve McQueen, es am Ende wirklich geschafft hatte. Er hatte tatsächlich den besten Rennfilm aller Zeiten gemacht. Daher, für alle sogenannten „Filmkritiker“, die so etwas nicht zu würdigen wissen:
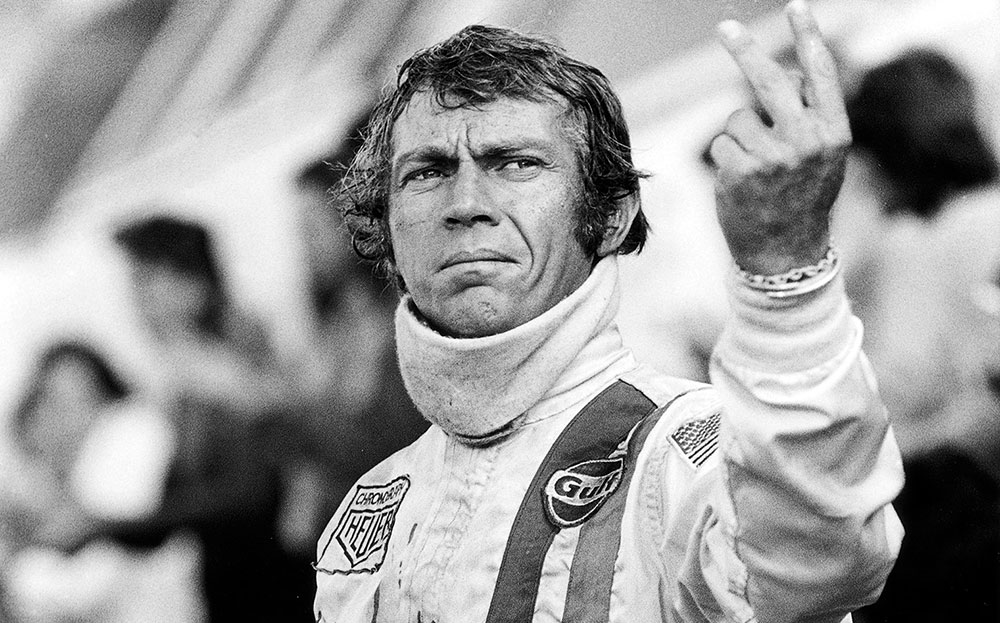
Und für alle anderen: Vielen Dank für eure Begleitung bei diesem intensiven Ausflug und viel Spaß beim Abtauchen in die geschichtlichen Details.
Amazon Partner Links: